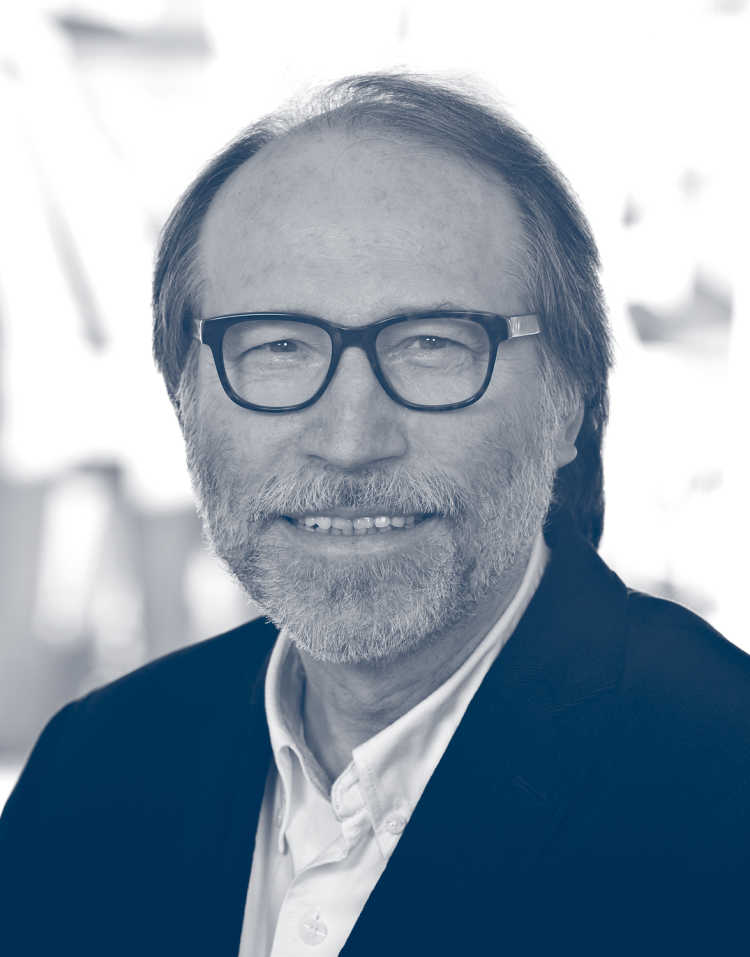- Startseite
- Publikationen
- GIGA Focus
- The Many Faces of Latin American Presidentialism
GIGA Focus Lateinamerika
Die vielen Gesichter des lateinamerikanischen Präsidentialismus
Nummer 1 | 2016 | ISSN: 1862-3573

Politische Entwicklungen in Lateinamerika (LA) haben die wissenschaftliche Debatte zur Demokratieentwicklung maßgeblich beeinflusst. Die derzeitigen schweren politischen Krisen in Brasilien und Venezuela veranschaulichen sowohl die strukturellen Defizite des in LA vorherrschenden Systemtypus der Präsidialdemokratie als auch die institutionellen Mechanismen, die das Überleben der lateinamerikanischen Spielarten des Präsidentialismus bislang ermöglicht haben, wenn auch unter großen Herausforderungen.
In Lateinamerika entwickelten sich unterschiedliche Modelle präsidentieller Demokratie. Dazu gehören sowohl verschiedene Spielarten eines Mehrheitspräsidentialismus und präsidentieller Dominanz als auch der „Koalitionspräsidentialismus“ und andere ad-hoc-Lösungen im Fall von Minderheitsregierungen.
Der Koalitionspräsidentialismus, wie er in Brasilien praktiziert wird, war eine innovative lateinamerikanische Lösung, um politische Blockaden zu überwinden. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ein Präsident ohne unterstützende Koalition möglicherweise politisch nicht überlebt.
Während in Brasilien der Kongress versucht, Präsidentin Rousseff mittels eines Amtsenthebungsverfahrens abzusetzen, inszeniert der venezolanische Präsident Maduro einen konstitutionellen Staatsstreich, um den Kongress zu entmachten. In beiden Fällen steht dem Präsidenten eine feindliche Mehrheit im Kongress gegenüber, aber die Lösung der daraus resultierenden Blockade fällt jeweils unterschiedlich aus.
Bei einem politischen Patt können Präsidenten versuchen, den Kongress zu umgehen und zu entmachten. Minderheitspräsidenten sehen sich aber auch zum Rücktritt gezwungen oder werden durch ein Amtsenthebungsverfahren bzw. institutionelle Äquivalente zu einem „Misstrauensvotum“ abgesetzt.
Fazit
Falls es Präsidenten nicht gelingt, ihre Parteien oder Koalitionen zu kontrollieren, können sie trotz fester Amtszeiten vorzeitig zum Rücktritt gezwungen werden. Einige Wissenschaftler fordern deshalb Verfassungsreformen, die vorgezogene Neuwahlen ermöglichen. Wir argumentieren demgegenüber, dass das formale Amtsenthebungsverfahren durch ein Misstrauensvotum (mit Zweidrittelmehrheit) ersetzt werden sollte. In diesem Fall wäre die politische Debatte weniger normativ aufgeladen, denn die moralische Integrität des amtierenden Präsidenten würde nicht infrage gestellt, und sie würde stärker unter politisch-programmatischen und parteipolitischen Gesichtspunkten geführt.
Lateinamerika als Vorreiter der dritten Demokratisierungswelle
Im Jahr 1990 veröffentlichte Juan Linz im Journal of Democracy einen einflussreichen Artikel mit dem Titel „The Perils of Presidentialism“ (Die Tücken des Präsidentialismus), in dem er keine sehr günstige Prognose für die gerade etablierten demokratischen und präsidentiellen Regime Lateinamerikas abgab. Diese skeptische Sichtweise wurde durch die politischen Entwicklungen in den folgenden Dekaden nicht bestätigt. Die jüngste Ausgabe des Bertelsmann Transformation Index (BTI) klassifiziert 17 von 19 politischen Systemen der Region als Demokratien; allerdings werden nur einige wenige als konsolidierte Demokratien eingeordnet, die meisten als defekte Demokratien.
Seit Jahresbeginn 2016 haben sich in Venezuela und Brasilien tiefe politische Krisen entwickelt. Obwohl es sich um zwei extreme Beispiele handelt, können sie im Sinne von Juan Linz und anderen politikwissenschaftlichen Klassikern der Demokratisierung als für Präsidialdemokratien typische und voraussehbare Krisen angesehen werden. In beiden Fällen sind die Präsidenten mit einer oppositionellen Mehrheit im Kongress konfrontiert: In Brasilien greift der Kongress auf das in der Verfassung vorgesehene Instrument des Amtsenthebungsverfahrens zurück, um Präsidentin Rousseff zum Amtsverzicht zu zwingen. Demgegenüber manipuliert Präsident Maduro in Venezuela die Spielregeln des politischen Entscheidungsprozesses, um einen von seinen politischen Gegnern dominierten und auf Konfrontation ausgerichteten Kongress zu entmachten. Beide Krisenkonstellationen und Lösungsinstrumente sind für die Region nicht neu. Das aktuelle Amtsenthebungsverfahren in Brasilien ähnelt früheren präsidentiellen Krisen während der dritten Demokratiewelle, als Präsidenten unter dem Druck ungünstiger Mehrheitsverhältnisse und oft auch unter Protesten auf der Straße die Macht abgeben mussten, bevor ihre in der Verfassung vorgesehene Amtszeit abgelaufen war. Auch wenn diese Präsidenten die Macht verloren, überlebte die Demokratie. Demgegenüber ähnelt der venezolanische Fall dem Lösungsmodell des Staatsstreichs von oben (auto-golpe) – wie etwa in Peru 1992, als der Präsident den Kongress verfassungswidrig auflöste und es zu einem Zusammenbruch des demokratischen Systems kam.
Der lateinamerikanische Präsidentialismus gleicht einem Chamäleon, er wechselt die Farbe in Reaktion auf seine Umwelt – aber er ist immer noch dasselbe politische Tier. Während das institutionelle Gefüge in Präsidialdemokratien politische Blockaden begünstigt, sind es letztlich die politischen Akteure, die diese Blockadesituationen verursachen und gegebenenfalls auch wieder auflösen. Und sie handeln nicht in einem sozioökonomischen Vakuum: In Brasilien und Venezuela führte der wirtschaftliche Niedergang dazu, dass die Präsidenten zunehmend an Rückhalt in der Bevölkerung verloren.
Die lateinamerikanische Debatte zur (präsidentiellen) Demokratie
Politische Entwicklungen in LA haben immer wieder inhaltsreiche, dauerhafte und kontroverse akademische Debatten über die Demokratie und ihre Defizite entfacht. Die wissenschaftliche Literatur in der Region hat der Funktionsweise demokratischer Institutionen besondere Aufmerksamkeit gewidmet, mit einem Schwerpunkt auf dem Präsidentialismus. Die akademische und politische Reflektion darüber, wie diese Institutionen verbessert werden können, hat eine lange Tradition. Seit den 1970er Jahren hat LA zudem auf signifikante Weise zur allgemeinen Theoriebildung in der vergleichenden Politikwissenschaft beigetragen. Renommierte Wissenschaftler, wie etwa Guillermo O’Donnell, haben die Forschung zu modernen autoritären Regimen um das Konzept des bürokratischen Autoritarismus bereichert. Wissenschaftlern aus der Region kam zudem eine zentrale Bedeutung in dem vergleichenden Forschungsvorhaben zum Zusammenbruch von Demokratien zu, das von Juan Linz und Alfred Stepan koordiniert wurde (Linz und Stepan 1978). Einen Zusammenbruch von Demokratien kann es nicht geben, wenn es nicht zuvor Demokratien gegeben hat. Daran wird deutlich, dass die Demokratie in LA über eine längere Tradition als in manch anderen Weltregionen verfügt.
Entwicklungen in LA hatten auch einen besonderen Stellenwert in der Literatur zu den demokratischen Transitionsprozessen. Zusammen mit Portugal, Spanien und Griechenland gehörten lateinamerikanische Länder zu den Vorreitern der dritten Demokratisierungswelle, die in den 1970er Jahren einsetzte. Tatsächlich enthält das 1986 veröffentlichte Buch Transitions from Authoritarian Rule (herausgegeben von Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter und Laurence Whitehead) Beiträge zu Südeuropa und Lateinamerika. Juan Linz entfachte eine breite intellektuelle Debatte über die Vorzüge der parlamentarischen Demokratie und die Gefahren des Präsidentialismus (einschließlich semipräsidentieller Modelle). In Brasilien gab es 1993 sogar ein Referendum über die Regierungsform (präsidentielle versus parlamentarische Demokratie). Später analysierte O’Donnell kritisch die „braunen Flecken“ der Demokratie und die Defizite im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht, wozu er den Begriff der „delegativen Demokratie“ einführte. Andere lateinamerikanische Wissenschaftler haben innovative analytische Konzepte wie den „Hyperpräsidentialismus“ und den „Koalitionspräsidentialismus“ entwickelt. Heutzutage gehören diese Konzepte zum akademischen Mainstream und haben über die Region hinaus das analytische Rüstzeug für die Untersuchung politischer Institutionen in Entwicklungsländern erweitert. In jüngster Vergangenheit haben die Vertreter des „neuen Konstitutionalismus“ eine partizipativere und sozial inklusivere Form der Demokratie für LA entworfen.
Die breite und anhaltende wissenschaftliche Debatte in LA über Demokratiedefizite wird durch die Existenz einer großen Zahl unabhängiger Universitäten, Forschungsinstitute und Think Tanks erleichtert. Im Jahr 2001 hat beispielsweise die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank (IDB) eine Studie mit dem Titel Democracies in Development veröffentlicht, an der viele bekannte lateinamerikanische Wissenschaftler mitgewirkt haben. Sie analysierten die Auswirkungen unterschiedlicher Institutionen auf die Präsidialdemokratien und bewerteten Mechanismen, die zur besseren Regierungsführung beitragen sollen (eine zweite überarbeitete Auflage wurde 2007 veröffentlicht). Ein von der IDB im Jahr 2006 veröffentlichter Band mit dem Titel Politics of Policies enthält eine vergleichende Analyse politischer Institutionen und Praktiken in lateinamerikanischen Präsidialsystemen, um herauszufinden, warum in einigen Ländern Reformen dauerhaft sind und es in manchen Ländern leichter gelingt, Politiken zu verändern, die sich nicht bewährt haben.
Derzeit werden die Ereignisse in Brasilien und Venezuela unter lateinamerikanischen Wissenschaftlern (wie auch unter LA-Experten im Ausland) umfassend diskutiert. Dabei werden einmal mehr ältere Erklärungsansätze einer Revision unterzogen sowie neue Konzepte und Vorschläge für institutionelle Veränderungen eingebracht. In letzter Zeit wurde den Thesen von Aníbal Pérez-Liñan zur Bedeutung eines parlamentarischen „Schutzschildes“ gegen mögliche Amtsenthebungsverfahren und den Überlegungen von Leiv Marsteintredet hinsichtlich der Flexibilisierung der Amtszeit von Präsidenten erneut Aufmerksamkeit zuteil. Zugleich gibt es auch ein neu erwecktes Interesse an einigen der klassischen Texte zur präsidentiellen Demokratie.
Die Tücken des Präsidentialismus
In seinem berühmten Artikel von 1990 ging Juan Linz von der Beobachtung aus, dass die meisten stabilen Demokratien in Europa und im Commonwealth zu jener Zeit parlamentarische Demokratien waren. Demgegenüber waren präsidentielle Regime entweder autoritär oder instabil. Er argumentierte, dass die Instabilität präsidentieller Demokratien auf ihr Grundmerkmal zurückzuführen sei, nämlich das Prinzip der doppelten Legitimität: Sowohl der Präsident als auch die Legislative leiteten ihre Macht aus Wahlen ab und beide Institutionen würden für eine feste Amtszeit gewählt. Die feste Amtszeit mache das Präsidialsystem rigide und erschwere die Krisen- und Konfliktbewältigung. Demgegenüber stünden der parlamentarischen Demokratie sehr viel flexiblere Lösungen zur Verfügung, einschließlich der Auflösung des Parlaments, des Misstrauensvotums und der Möglichkeit vorgezogener Neuwahlen. Die Direktwahl von Exekutive und Legislative in Präsidialsystemen gebe beiden Gewalten, dem Präsidenten und dem Kongress, direkte demokratische Legitimität und provoziere auf diese Weise inter-institutionelle Machtkämpfe, bei denen nicht absehbar sei, wer sich durchsetzen werde, sollte es wirklich zu einem offenen Konflikt kommen. Linz argumentierte, das Fehlen von Mehrheiten im Kongress mit der Folge, dass die Wahrscheinlichkeit politischer Blockaden zunimmt, sei im Wesen präsidentieller Systeme begründet.
Die lateinamerikanischen Präsidialdemokratien haben jedoch überlebt, seit die „dritte Welle“ demokratischer Transition 1978 einsetzte. Die Probleme, die Linz im Präsidentialismus diagnostiziert hatte, waren weniger allgegenwärtig als befürchtet. Schon Anfang der 1990er Jahre haben Wissenschaftler darauf hingewiesen, dass die potenziellen Risiken, die Linz den Präsidialdemokratien zugeschrieben hatte, eigentlich nur in bestimmten institutionellen Konstellationen anzutreffen sind, insbesondere in der „schwierigen Kombination“ aus Präsidentialismus und Mehrparteiensystem, in der es für Präsidenten problematisch sein kann, sich die notwendige legislative Unterstützung für ihr politisches Programm zu sichern. In einer solchen Situation wird die Fähigkeit oder Unfähigkeit von Präsidenten, mangelnde parlamentarische Unterstützung zu überwinden, von institutionellen Faktoren bestimmt, wie dem Grad der Fragmentierung des Parteiensystems oder den verfassungsmäßigen Kompetenzen der Exekutive. Aber sie hängt auch sehr stark von deren strategischen Kalkülen ab: Präsidenten verfügen über viele verfassungskonforme Kompetenzen, um den Gesetzgebungsprozess zu beeinflussen (die sogenannten Kompetenzen zur Festlegung der politischen Agenda, einschließlich unilateraler Gesetzgebung mittels Dekreten, denen Gesetzeskraft zukommt), aber sie schöpfen diese Möglichkeiten unterschiedlich aus. Es gab Präsidenten, die diese Befugnisse nutzten, um allein zu regieren; sie verzichteten darauf, sich um Mehrheiten im Kongress zu bemühen, und setzten stattdessen auf eine imperiale Strategie, indem sie den Kongress und die dort vertretenen Parteien umgingen. Andere Präsidenten benutzten ihre unilateralen Kompetenzen im Rahmen einer starken Gewaltenverschränkung zwischen Legislative und Exekutive, und zwar hauptsächlich, aber nicht ausschließlich durch die Bildung von Koalitionskabinetten.
Koalitionspräsidentialismus und der Sturz von Präsidenten
In der Praxis konnten die dem lateinamerikanischen Präsidentialismus innewohnenden Gefahren durch politische und institutionelle Neuerungen verringert werden. Erstens zeigte sich in LA, dass in Präsidialdemokratien stabile Mehrparteienkoalitionen gebildet werden können, selbst in Ländern mit einem nur schwach institutionalisierten Parteiensystem. Insofern war der „Koalitionspräsidentialismus“ eine spezifische strategische Antwort auf vorgegebene Systemzwänge. In dieser Variante präsidentieller Demokratie fungiert der direkt gewählte Präsident als „Koalitionsbilder“ und benutzt seine Ernennungsrechte dazu, Minister aus verschiedenen Parteien zu rekrutieren und ein Gesetzgebungskartell zu bilden, das seine Vorschläge im Kongress unterstützt. Erfolgreiche Beispiele für Koalitionspräsidentialismus waren in ganz Lateinamerika zu beobachten, von Brasilien über Chile bis Uruguay, und eine wachsende Literatur zum Thema hat gezeigt, dass Koalitionen in Präsidialdemokratien nicht zwingend ad hoc gebildet werden und kurzlebig sind, sondern denen in parlamentarischen Demokratien ähneln. In Brasilien ist es mittlerweile für Präsidenten Routine, während ihrer Amtszeit wechselnden Koalitionsregierungen vorzustehen, um ihren Rückhalt im Kongress zu sichern. Neben der Verteilung von Kabinettsposten haben Präsidenten auch auf andere Mechanismen zurückgegriffen, um Konflikte zwischen Koalitionspartnern beizulegen und die Kontrolle über den Gesetzgebungsprozess aufrechtzuerhalten; dazu gehören ihre Befugnisse zur Kontrolle und Steuerung der politischen Agenda, aber auch klientelistische Praktiken. Die Kombination all dieser Merkmale konstituiert ein Regierungsmodell, das signifikant von der Reinform präsidentieller Demokratie abweicht, wie wir sie in den USA vorfinden. Das US-System ist einzigartig und nicht repräsentativ für die Gesamtheit der existierenden Präsidialdemokratien.
Die geschilderte Spielart des lateinamerikanischen Präsidentialismus zeigt somit, dass in Präsidialdemokratien Koalitionen möglich und Minderheitspräsidenten nicht notwendig schwach sind und dass nicht zwingend eine Konfrontationslogik in den Beziehungen von Kongress und Präsident vorherrschend ist. Koalitionspräsidentialismus setzt allerdings einen geringen Grad politischer Polarisierung voraus, sodass die Zusammenarbeit von Parteien eines breiten ideologischen Spektrums möglich wird; er setzt Präsidenten voraus, die sich an die Spielregeln halten und Beschränkungen akzeptieren, die sich aus ihrem Minderheitsstatus ergeben, und die zur Machtteilung bereit sind. Wenn Minderheitspräsidenten allerdings der Versuchung unterliegen, ihre weitreichenden Notstandsvollmachten und Machtbefugnisse zur Gestaltung der politischen Agenda zu missbrauchen, um im Alleingang Gesetze zu verabschieden, kann sie dieses Verhalten in ernsthafte Schwierigkeiten bringen.
Eine unzureichende parteipolitische Unterstützung im Kongress kann insbesondere dann für Präsidenten zu einem Problem werden, wenn sie noch mit anderen Herausforderungen konfrontiert sind, wie etwa einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, Skandalen, Unzufriedenheit in der Bevölkerung und öffentlichen Protestbewegungen, und dabei keine Führungsstärke zeigen. Weil er vom Volk in sein Amt gewählt wurde, kommt dem Präsidenten zentrale Bedeutung im politischen System zu. Insofern wirkt sich der Eindruck, ein Präsident bekomme die Probleme des Landes und der Regierung nicht in den Griff, direkt auf dessen Popularität aus und verringert zugleich die Kooperationsbereitschaft der im Kongress vertretenen Parteien bzw., im Fall von Regierungskoalitionen, der Koalitionspartner.
Im September 2015 trat der guatemaltekische Präsident Otto Perez Molina, der sich schweren Korruptionsvorwürfen ausgesetzt sah, unter dem Druck des Kongresses und von Straßenprotesten zurück. Derzeit sieht sich Präsidentin Dilma Rousseff mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontiert. Tatsächlich wurde seit den 1980er Jahren der Verbleib vieler lateinamerikanischer Präsidenten im Amt trotz streng festgelegter Amtszeiten infrage gestellt. 17 Präsidenten wurden gezwungen, vor Ablauf ihrer laut Verfassung vorgesehenen Amtszeit die Macht abzugeben. Dieses Scheitern von Präsidentschaften hat jedoch nicht zum Bruch der demokratischen Ordnung geführt, wie ursprünglich in Zusammenhang mit den diagnostizierten Gefahren des Präsidentialismus angenommen wurde, obwohl der Sturz der Präsidenten zumeist durch außerordentlich konfliktreiche politische Situationen ausgelöst wurde.
Demnach haben schwere inter-institutionelle Konflikte zwischen Präsident und Kongress häufig zu einem vorzeitigen Wechsel im Präsidentenamt geführt. Dies ist nachweislich ein innovatives institutionelles Merkmal des Präsidentialismus in LA. Sehr oft sind Präsidenten zurückgetreten, wenn sie unter Druck gesetzt wurden, aber sie wurden vielfach auch direkt vom Kongress abgesetzt. Diese vom Kongress erzwungenen Wechsel weisen häufig Ähnlichkeit mit den flexiblen Lösungen auf, die in parlamentarischen Regimen bei der Bewältigung von Krisen zur Anwendung kommen (nämlich vorgezogene Neuwahlen, Misstrauensvoten und die Wahl des Nachfolgers im Präsidentenamt durch den Kongress). Selbst Amtsenthebungsverfahren, die eine qualifizierte Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern benötigen und gewissermaßen der Ausnahmemechanismus zur Konfliktlösung in Präsidialverfassungen sind, können in der Praxis einem Misstrauensvotum ähnlich sein, wie beispielsweise bei der Entmachtung von Präsident Fernando Lugo in Paraguay.
Positiv gesehen haben die politischen und institutionellen Neuerungen des lateinamerikanischen Präsidentialismus Mechanismen geschaffen, um mit inter-institutionellen Konflikten umgehen zu können, und sie haben je nach Konstellation das Risiko eines Zusammenbruchs der demokratischen Ordnung mehr oder weniger stark verringert. Andererseits wurde die Bildung und Sicherung von Koalitionen im Kongress zu einer großen Herausforderung sowohl für den Präsidenten als auch für das präsidentielle Regime. Dabei kamen auch klientelistische und korrupte Praktiken zur Anwendung. Der „flexible“ Gebrauch bestimmter konstitutioneller Mechanismen, um Präsidenten zu entlassen, hat sich im Kontext politischer Polarisierung gleichfalls als problematisch erwiesen.
Der Koalitionspräsidentialismus in der Krise: das Amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff
Nach mehr als 40-stündiger Debatte stimmte das brasilianische Abgeordnetenhaus am späten Abend des 17. April 2016 über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsidentin Dilma Rousseff ab; 367 von 513 Abgeordneten unterstützten den Antrag. Dies war eine komfortable Mehrheit – deutlich mehr als die für eine Zweidrittelmehrheit notwendigen 342 Stimmen –, um den Antrag an die zweite Kammer weiterzuleiten. Vor dem Kongressgebäude feierten grün-gelb gekleidete und mit der brasilianischen Nationalfahne drapierte Demonstranten, die das Amtsenthebungsverfahren begrüßten. Eine Absperrung trennte sie von den Unterstützern Dilma Rousseffs, die in Rot gekleidet waren. Die Abgeordneten hatten jeweils 30 Sekunden Zeit, um ihr Votum zu begründen: Diejenigen, die zugunsten der Präsidentin abstimmten, bezeichneten das Amtsenthebungsverfahren ausnahmslos als ungerechtfertigten Staatsstreich. Die Anhänger des Amtsenthebungsverfahrens begründeten ihre Entscheidung mit einem zusammengesuchten Strauß von Argumenten, die weit über den eigentlichen Normenverstoß hinausgingen, der dem Verfahren zugrundelag, nämlich der Manipulation am Staatshaushalt des vergangenen Jahres, um das Haushaltsdefizit kleiner erscheinen zu lassen, als es tatsächlich war.
Die hohe Stimmenzahl für die Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens ist ohne genauere Kenntnis des politischen Umfelds nicht nachvollziehbar. Präsidentin Rousseff leidet unter extrem niedrigen Zustimmungswerten, die das Ergebnis verschiedener ungünstiger politischer und ökonomischer Faktoren sind: Das Land befindet sich in einer tiefen Rezession, die Inflationsrate und die Arbeitslosenquote liegen bei 10 Prozent. Die Aufdeckung der Petrobras-Korruptionsaffäre, in die sowohl die Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores, PT) der Präsidentin als auch ihre Koalitionspartner und viele andere verstrickt sind, hat die Bürger wütend gemacht und Proteste ausgelöst. Auch wenn es immer noch keine Beweise dafür gibt, dass die Präsidentin direkt involviert war, glauben viele Bürger, dass sie gewusst haben muss, was vor sich ging. Im Verlauf der Ereignisse sind latente Rivalitäten zwischen den Koalitionspartnern sichtbar geworden. In der Tat hat das Amtsenthebungsverfahren erst Fahrt aufgenommen, als es zu einem Bruch zwischen dem PT und dem Hauptkoalitionspartner PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) kam, der überdies das Amt des Vizepräsidenten und das Präsidium beider Kammern kontrolliert. Wie es Sergio Abranches, der einst den Begriff des „Koalitionspräsidentialismus“ prägte, treffend auf den Punkt gebracht hat: Das Amtsenthebungsverfahren ist kein Gerichtsverfahren, sondern ein politischer Prozess im Rahmen des durch die Verfassung vorgegebenen prozeduralen Rahmens. Auch wenn die Auslegung der jeweiligen Gründe für ein Amtsenthebungsverfahren immer zu rechtlichen Kontroversen einlädt, geht es im Kern darum, dass ein Präsident ohne einen parteipolitischen Schutzschild im Kongress nur geringe Chancen hat, ein solches Verfahren zu überstehen. So gab es Fälle, in denen Parlamente einen nachweislich Schuldigen nicht des Amtes entheben konnten, und Fälle, in denen Präsidenten ihr Amt verloren, obwohl keine triftigen Beweise gegen sie vorgelegt werden konnten.
Alle brasilianischen Präsidenten seit dem Übergang zur Demokratie sahen sich der Drohung eines Amtsenthebungsverfahrens ausgesetzt. Aber nur ein Versuch, der mittlerweile 24 Jahre zurückliegt, hatte wirklich Erfolg. Dieser richtete sich gegen Fernando Collor de Melo, den ersten wieder direkt vom Volk gewählten Präsidenten nach zwischenzeitlich 21 Jahren Militärherrschaft. Collors Versuch, eine radikale wirtschaftliche Reformagenda zur Inflationsbekämpfung durchzusetzen, führte zu einer Rezession, steigender Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit im Volk. Er war ein Präsident ohne die Unterstützung einer bedeutenden eigenen Partei und regierte in imperialem, konfrontativem Stil bei nur geringer Unterstützung durch andere im Kongress vertretene Parteien. Dilma Rousseff wird von ihrer Partei unterstützt – die PT ist eine wichtige, aber gleichwohl in der Minderheit befindliche Partei in einem hochgradig fragmentierten Kongress –, aber sie kann sich nicht länger auf eine Koalition stützen. Derzeit obliegt es dem brasilianischen Senat, über den Fortgang des Amtsenthebungsverfahrens zu entscheiden. Ihre politischen Überlebenschancen sind, wenn überhaupt, äußerst gering.
Das autokratische Gesicht präsidentieller Demokratie: zurück in die 1990er Jahre?
Während der Koalitionspräsidentialismus die lateinamerikanischen Präsidialdemokratien erneuert und ihnen eine auf Konsensbildung gerichtete Prägung gegeben hat, ist auch die autokratische Tradition niemals ausgestorben. Derzeit ist die Tochter des ehemaligen peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori eine der beiden Kandidaten in der Stichwahl um die peruanische Präsidentschaft. Fujimori (wie auch Carlos Menem und Fernando Collor de Melo) inspirierte Guillermo O‘Donnell Anfang der 1990er Jahre zu seinem bekannten Konzept der „delegativen Demokratie“. In einer delegativen Demokratie sieht sich ein Individuum während eines begrenzten Zeitraums als Verkörperung und Interpret der höchsten nationalen Interessen, um unbeeinträchtigt von politischen Institutionen und organisierten Gruppen agieren zu können. In derartigen Regimen führt das Erbe autoritärer Traditionen in Kombination mit einer tiefen sozialen und ökonomischen Krise zu einem exaltierten Status des Präsidenten und schwachen, stark manipulierten legislativen und rechtsprechenden Staatsorganen. Der Begriff des „Hyperpräsidentialismus“ wurde ebenfalls in diesen Jahren geprägt und geht auf Carlos Nino zurück. Er betont die Übermacht der Exekutive, wie sie in der Verfassung verankert ist, und den exzessiven Rückgriff auf unilaterale Mechanismen bei der Entscheidungsfindung. Alle drei genannten Präsidenten agierten in dieser Hinsicht ähnlich, aber es war Fujimori, der einen Staatsstreich von oben inszenierte, als sich der Kongress seinen neoliberalen Reformplänen widersetzte. Mittels eines Dekrets löste er den Kongress auf, übertrug alle gesetzgebende Gewalt auf die Exekutive und setzte die Verfassung weitgehend außer Kraft. Neuwahlen wurden ausgeschrieben und eine neue Verfassung verabschiedet, die aus dem Kongress ein Einkammerparlament machte, das weitgehend von Anhängern Fujimoris dominiert wurde.
Im Gegensatz zu Fujimori konnte Präsident Menem auf die Unterstützung seiner Partei, der Peronisten, bauen, die während seiner zwei Amtszeiten über vorteilhafte Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses verfügte. Menem zeigte sich als außerordentlich risikobereiter Politiker und scheute sich nicht, in der Grauzone der Verfassung mit Dekreten zu regieren und den Obersten Gerichtshof mit Gefolgsleuten zu besetzen. Aber der Schlüssel zum Erfolg seines ehrgeizigen politischen Programms und seiner über einen langen Zeitraum ungefährdeten Führungsrolle war seine gleichzeitige Bereitschaft, mit seiner Partei und deren Verbündeten im Kongress zusammenzuarbeiten.
Die politische Landschaft in LA war immer geprägt von Präsidenten, die dazu neigten, einseitig ihre Machtbefugnisse zu erweitern, und sich auf einen starken Rückhalt bei den Wählern berufen konnten, beispielsweise nach dem Linksruck in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts. Hugo Chávez, Rafael Correa und Evo Morales stehen für einen delegativen und hyperpräsidentiellen Regierungsstil, ungeachtet ihres partizipatorischen Diskurses. Die in ihrer Amtszeit verabschiedeten Verfassungen, die während der Welle des „neuen Konstitutionalismus“ mit einer gewissen Begeisterung aufgenommen wurden, entsprechen in dieser Hinsicht sehr dem traditionellen lateinamerikanischen Präsidentialismus. Die lateinamerikanischen Institutionen und Verfassungen sind nicht statisch, aber einige ihrer Facetten haben sich als besonders resistent erwiesen. Seit Beginn der gegenwärtigen Demokratieperiode im Jahr 1978 wurden 16 neue Verfassungen verabschiedet, die meisten in den 1980er und 1990er Jahren. Darüber hinaus wurden in LA allein zwischen den Jahren 2000 und 2015 insgesamt 275 Verfassungsänderungen angenommen, während in der gleichen Periode nur drei neue Verfassungen in Kraft traten. Während die lateinamerikanischen Verfassungen insgesamt inklusiver geworden sind und mehr soziale und partizipative Rechte beinhalten, argumentieren einige Autoren, wie etwa Roberto Gargarella, im „Maschinenraum der Verfassungen“ habe sich dennoch wenig verändert. Als „Maschinenraum“ bezeichnet er die Verfassungsbestimmungen zu Machtbefugnissen, mit denen die Kompetenzen der politischen Institutionen und Akteure voneinander abgegrenzt werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass einerseits sehr oft die präsidentiellen Kompetenzen zur Agendagestaltung und -kontrolle erweitert, andererseits jedoch häufig auch die Befugnisse von Kongress und Judikative ausgeweitet wurden. Die Umsetzung dieser sich widersprechenden Reformen hängt zu einem Großteil von den politischen Mehrheitsverhältnissen ab. Ein Präsident, der über eine breite Mehrheit verfügt, kann seine Machtbefugnisse gegebenenfalls dazu benutzen, den Kongress und die Judikative zu neutralisieren. Ein Minderheitspräsident kann demgegenüber von einer oppositionellen Mehrheit in die Enge getrieben werden. Dies ist eine reale Möglichkeit, denn die lateinamerikanischen Parteiensysteme sind aufgrund von Wahlrechtsreformen inklusiver und fragmentierter geworden. Darüber hinaus ist die in ihren verfassungsmäßigen Kompetenzen gestärkte Justiz ein weiterer Akteur mit potenzieller Vetomacht.
Venezuela: das autoritäre Gesicht des Präsidentialismus
Bei den Parlamentswahlen im Dezember 2015 hatte die Regierung des venezolanischen Präsidenten Maduro eine deutliche Niederlage erlitten. Daraufhin erhöhte die Regierungsmehrheit im scheidenden Kongress die Kontrolle über den Obersten Gerichtshof und ernannte unter grober Missachtung der Verfassung 13 neue Richter. Anschließend erwies sich der Oberste Gerichtshof als ein außerordentlich funktionales Instrument der Exekutive und entmachtete den neu gewählten oppositionellen Kongress. In einem ersten Schritt stellte das Gericht den Status dreier Abgeordneter infrage, die der Opposition zu einer Zweidrittelmehrheit im Kongress verholfen hätten – Voraussetzung für Verfassungsänderungen oder die Einberufung einer verfassunggebenden Versammlung. Zweitens legte es die Verfassung neu aus, um die Aufsichts- und Kontrollkompetenzen des Kongresses einzuschränken, und erklärte mit politisch-ideologischen Argumenten Gesetze für ungültig, etwa ein Amnestiegesetz für (aus Sicht der Opposition) politische Häftlinge. Drittens bestätigte es das Recht des Präsidenten, Gesetze per Dekret zu erlassen, obwohl der Kongress die Verlängerung einer entsprechenden Ermächtigung des Präsidenten abgelehnt hatte. Wir interpretieren dieses Verhalten als „konstitutionellen Staatsstreich“ des Präsidenten in Zusammenarbeit mit dem Obersten Gerichtshof. Javier Corrales hat dazu den Begriff des „autokratischen Legalismus“ geprägt, eine Herrschaftsstrategie mit einer langen Tradition in LA. Dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Getulio Vargas wird der Ausspruch zugeschrieben: „Für meine Freunde, was immer sie wollen, für meine Feinde das Gesetz.“ Die Neigung, das Recht parteiisch und einseitig gegen politische Gegner anzuwenden, ist nie ausgestorben. Unlängst wurde die Tendenz, mittels politisch unterwürfiger Gerichtshöfe die Verfassungen zu verändern oder neu zu interpretieren, in Nicaragua und Honduras wiederbelebt. In beiden Ländern hat der Oberste Gerichtshof eherne Verfassungsklauseln, welche die Wiederwahl von Präsidenten verbieten, für unwirksam erklärt und in beiden Fällen begünstigte die Entscheidung des Gerichts den jeweils amtierenden Präsidenten. Das Beispiel von Daniel Ortega in Nicaragua illustriert darüber hinaus die langlebige Tradition personalistischer Herrschaft und des caudillismo. Ursprünglich Revolutionsführer gegen eine personalistische autoritäre Diktatur entwickelte er sich später vom autokratischen Revolutionär zu einem politischen Akteur, der die demokratischen Spielregeln respektiert, um schließlich als personalistischer Herrscher in einer Demokratie mit stark autoritären Zügen zu enden.
Wenngleich es in Venezuela unter Chávez autokratische Tendenzen gab, können diese immer noch als Teil einer „delegativen Demokratie“ mit starken plebiszitären Komponenten gesehen werden. Maduro hat die Linie in Richtung Autoritarismus überschritten. Dies erklärt, warum er zurzeit im Konflikt mit dem Kongress und in der Pattsituation die Oberhand behält – unter demokratischen Bedingungen hat in einer Konfliktkonstellation im Allgemeinen der Kongress die besseren Karten. Allerdings hat Präsident Maduro die politische Funktionslogik des bolivarianischen Regimes nicht wirklich verändert. Denn während der Präsidentschaft von Hugo Chávez und zu Beginn der Amtszeit Maduros kontrollierte die Regierungspartei die Exekutive, die Legislative und die Judikative – daher gab es keine Konflikte zwischen diesen Staatsorganen.
„It’s the Economy, Stupid“
Wie es die Wahlkampfparole von Bill Clinton gegen den amtierenden Präsidenten George Bush in einer Phase wirtschaftlicher Stagnation ausdrückte, ist es auch hier die wirtschaftliche Lage, die – zumindest zum Teil – erklärt, warum zwei amtierende lateinamerikanische Präsidenten mit ernsthaften Problemen konfrontiert sind. Politische Krisen entstehen nicht in einem sozioökonomischen Vakuum. In Brasilien und Venezuela hat der wirtschaftliche Abwärtstrend den Verlust an Unterstützung für die Präsidenten in der Bevölkerung verstärkt. Auch wenn die regierende PT tief im Korruptionssumpf steckt, gilt das Gleiche für die wichtigsten Gegenspieler von Präsidentin Rousseff. Dass sich eine Koalition zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen die Präsidentin formiert hat, steht im Kontext eines ökonomischen Einbruchs und sozialer Polarisierung über Verteilungsfragen. Zwar kann die Amtsenthebung zu einer kurzfristigen Überwindung der politischen Pattsituation führen. Doch der erwartete wirtschaftliche Rückgang des brasilianischen BIP um 3,8 Prozent im laufenden und das Nullwachstum im kommenden Jahr – so die Voraussagen des IWF für das Land – werden dazu führen, dass weder der Weg aus der politischen noch aus der ökonomischen Krise einfach sein wird. Darüber hinaus ist die Politik jetzt sehr viel stärker polarisiert und von wechselseitigen Feindbildern geprägt als in den vorausgegangenen 20 Jahren.
In Venezuela ist die wirtschaftliche Krise noch tiefgreifender, mit einem derzeit um 8 Prozent schrumpfenden Bruttosozialprodukt und einer Inflationsrate von bis zu 500 Prozent. Indem sie das Verdikt der Wähler vom Dezember missachtete und nachfolgend den Kongress entmachtete, hat die Regierung deutlich die rote Linie zwischen einer defekten Demokratie und einem autoritären Regime überschritten. Es ist sehr schwer vorauszusehen, wie die politische Pattsituation, die parteipolitische Polarisierung und die wirtschaftliche Krise in Venezuela überwunden werden können. Dazu bedarf es möglicherweise des Drucks und der Unterstützung von außen. Im Kontext des wirtschaftlichen Abschwungs in Lateinamerika ist die Periode der „Schönwetterdemokratie“ scheinbar zu einem Ende gekommen und einige der „Gefahren“ und unerfreulicheren Seiten präsidentieller Demokratie gewinnen wieder an Virulenz.
Plädoyer für eine aufrichtige Lösung von Blockadesituationen
Präsidialdemokratien werden fortbestehen. Die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zu einem parlamentarischen demokratischen System ist sehr gering – weltweit gibt es kaum Veränderungen im Hinblick auf den jeweils etablierten Demokratietypus. Deshalb werden auch die strukturellen Herausforderungen, die den präsidentiellen Demokratien eigen sind, nicht verschwinden. Es besteht immer das Risiko, dass der Präsident im Parlament nicht über eine Mehrheit verfügt. Zwei extreme Lösungswege wurden in LA häufig eingeschlagen, wenn es zu einer politischen Blockadesituation kam: Entweder hat sich der Präsident durchgesetzt, indem er den Kongress umgangen oder sogar aufgelöst hat, oder der Kongress gewann die Oberhand und hat den Präsidenten abgesetzt. Beide Wege aus der Krise bedeuten eine kurzfristige Lösung, in beiden Fällen besteht aber auch das Risiko einer künftigen Belastung für die Demokratie. Wir sind der Meinung, dass die Risiken der ersten Variante höher sind, denn der Triumph des Präsidenten kann zu einer autoritären Form des Präsidentialismus und uneingeschränkter Machtkonzentration in der Exekutive führen. Auf der anderen Seite kann ein Triumph der Kongressmehrheit die politische Polarisierung verstärken, denn die Partei des Präsidenten wird argumentieren, der Kongress hintergehe die Wähler des Präsidenten bzw. das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen werde annulliert. Teilweise ist die stärkere politische Polarisierung auch darauf zurückzuführen, dass ein Amtsenthebungsverfahren die Verletzung von Normen oder ein Fehlverhalten im Amt durch den Präsidenten voraussetzt und direkte persönliche Anschuldigungen impliziert. In Wirklichkeit sind es aber die politischen Mehrheitsverhältnisse im Kongress, die über das Schicksal des Präsidenten entscheiden. Dies war eindeutig der Fall in Paraguay im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Lugo, und dies ist jetzt der Fall in Brasilien, wo die vorgetragenen Gründe für das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Rousseff zu einer enormen Kontroverse geführt haben. Es würde möglicherweise zu mehr Aufrichtigkeit beitragen, wenn in den lateinamerikanischen Verfassungen das Amtsenthebungsverfahren durch ein Misstrauensvotum (mit Zweidrittelmehrheit) ersetzt würde. In diesem Fall wäre die politische Debatte weniger normativ aufgeladen, denn die moralische Integrität des amtierenden Präsidenten würde nicht infrage gestellt, und würde stärker unter politisch-programmatischen und parteipolitischen Gesichtspunkten geführt werden, die oft den Hintergrund der Amtsenthebungsverfahren darstellen. Eine derartige semipräsidentielle Lösung würde die gegenwärtige politische Praxis in LA auch besser widerspiegeln. Driftet allerdings ein präsidentielles Regime in Richtung Autoritarismus ab (wie im venezolanischen Fall), dann verliert die Frage nach dem institutionellen Design an Bedeutung. In einem solchen Fall sollte die internationale Gemeinschaft in Erwägung ziehen, aktiv zu werden.
Die dem Präsidentialismus innewohnenden Risiken wie auch die politischen und institutionellen Neuerungen in LA, um mit diesen umzugehen, sind auch für politische Entscheidungsträger und Wissenschaftler in anderen Weltregionen von Relevanz. Schließlich haben sich präsidentielle oder semipräsidentielle Regime im Rahmen der dritten Demokratisierungswelle auch in anderen Regionen verbreitet. Wenn sich alle politischen Akteure an die demokratischen Spielregeln halten, sind Blockadesituationen in Präsidialdemokratien sehr wahrscheinlich. Die extremen Lösungen a la latina haben, wie sich gezeigt hat, ihre Kosten, aber sie sind immer noch besser als die Rückkehr zu autoritärer Herrschaft, wie sie in der Vergangenheit häufig das Ergebnis derartiger Krisen war.
Fußnoten
Literatur
Abranches, Sergio (2016), O consenso impossível e o agravamento da crise no presidencialismo de coalizão, in: ecopolitica, 18. April (2. Mai 2016).
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2016), Transformation Index BTI 2016, Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
Corrales, Javier (2015), Autocratic Legalism in Venezuela, in: Journal of Democracy, 26, 2, 37-51.
Gargarella, Roberto (2013), Latin American Constitutionalism, 1810-2010: The Engine Room of the Constitution, Oxford: Oxford University Press.
Inter-American Development Bank (IDB) (2006), The Politics of Policies: Economic and Social Progress in Latin America, New York, NY: IDB.
Linz, Juan J. (1990), The Perils of Presidentialism, in: Journal of Democracy, 1, 1, 51-69.
Linz, Juan, und Alfred Stepan (Hrsg.) (1978), The Breakdown of Democratic Regimes, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Marsteintredet, Leiv, und Einar Berntzen (2008), Reducing the Perils of Presidentialism in Latin America through Presidential Interruptions, in: Comparative Politics, Oktober, 41, 83-101.
Nino, Carlos (1996), Hyperpresidentialism and Constitutional Reform in Argentina, in: Arend Lijphart und Carlos H. Waisman (Hrsg.), Institutional Design in New Democracies: Eastern Europe and Latin America, Boulder, CO: Westview Press.
O’Donnell, Guillermo (1973), Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics, Berkeley, CA: University of California, Institute of International Studies.
O’Donnell, Guillermo (1994), Delegative Democracy, in: Journal of Democracy, 5, 1, 55-69.
O’Donnell, Guillermo (2004), Why the Rule of Law Matters, in: Journal of Democracy, 15, 4, 32-46.
O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter und Laurence Whitehead (Hrsg.) (1986), Transitions from Authoritarian Rule, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Payne, J. Mark, et al. (2001), Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America, New York, NY: IDB.
Pérez-Liñan, Aníbal (2007), Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, Cambridge: Cambridge University Press.
Gesamtredaktion GIGA Focus
Redaktion GIGA Focus Lateinamerika
Forschungsprojekt
Regionalinstitute
Forschungsschwerpunkte
Wie man diesen Artikel zitiert
Llanos, Mariana, und Detlef Nolte (2016), Die vielen Gesichter des lateinamerikanischen Präsidentialismus, GIGA Focus Lateinamerika, 1, Hamburg: German Institute for Global and Area Studies (GIGA), http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-46909-7
Impressum
Der GIGA Focus ist eine Open-Access-Publikation. Sie kann kostenfrei im Internet gelesen und heruntergeladen werden unter www.giga-hamburg.de/de/publikationen/giga-focus und darf gemäß den Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz Attribution-No Derivative Works 3.0 frei vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies umfasst insbesondere: korrekte Angabe der Erstveröffentlichung als GIGA Focus, keine Bearbeitung oder Kürzung.
Das German Institute for Global and Area Studies (GIGA) – Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg gibt Focus-Reihen zu Afrika, Asien, Lateinamerika, Nahost und zu globalen Fragen heraus. Der GIGA Focus wird vom GIGA redaktionell gestaltet. Die vertretenen Auffassungen stellen die der Autorinnen und Autoren und nicht unbedingt die des Instituts dar. Die Verfassenden sind für den Inhalt ihrer Beiträge verantwortlich. Irrtümer und Auslassungen bleiben vorbehalten. Das GIGA und die Autorinnen und Autoren haften nicht für Richtigkeit und Vollständigkeit oder für Konsequenzen, die sich aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen ergeben.