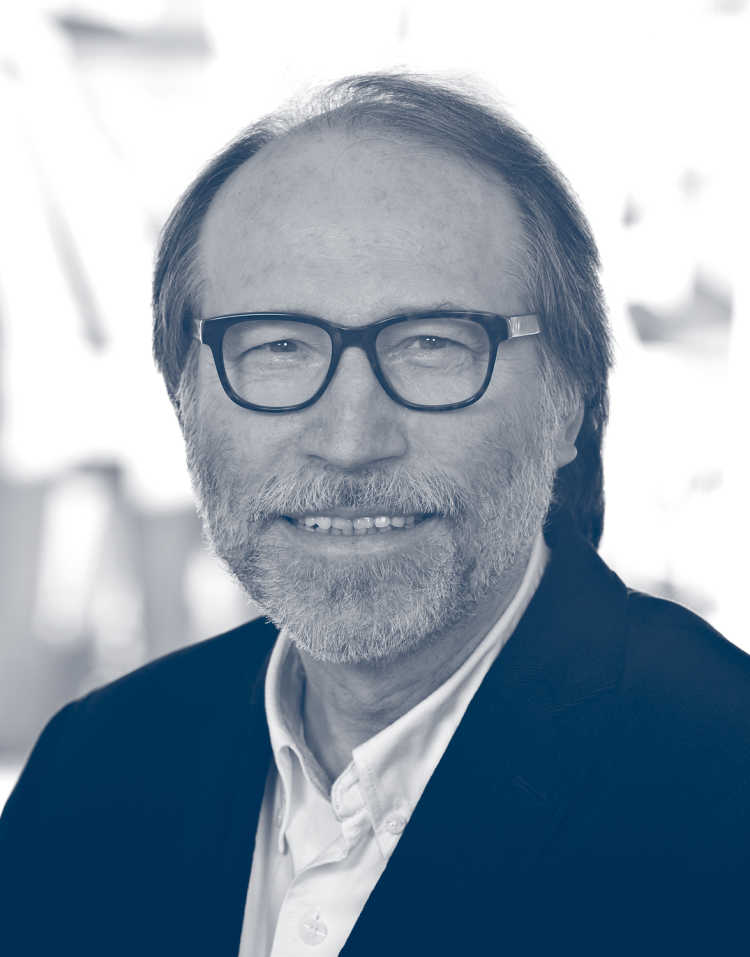- Home
- Publications
- GIGA Focus
- Umstrittene Freihandelsabkommen mit der EU: Afrika unter (Handels-)Druck
GIGA Focus Africa
Economic Partnership Agreements with the EU: Trade-Offs for Africa
Number 7 | 2016 | ISSN: 1862-3603

The implications of reciprocal free trade agreements between the European Union (EU) and the five subregions in sub-Saharan Africa (SSA) have been fiercely contested. Without doubt, the deals being negotiated in the Economic Partnership Agreements (EPAs) hold both risks and opportunities. The question remains, however, under which conditions the benefits can outweigh the risks.
Only one regional Economic Partnership Agreement (EPA) has been ratified to date in SSA. The EPA with the Southern African group entered into force on 10 October 2016. Interim agreements with individual countries have been ratified by Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroon, Mauritius, Madagascar, Zimbabwe, and the Seychelles. Difficult negotiations are ongoing at the regional level, with the East African group wavering on signing a regional EPA in what is currently yet another extension period lasting until the beginning of 2017.
Many African countries see the EPAs as a reflection of the predominance of European economic interests and fear a contraction of their public policy space.
Lifting barriers to European imports will place pressure on the agricultural and poorly developed manufacturing sectors in Africa. Considering the low competitiveness of most African economies, the envisaged transition period of 15 to 20 years appears highly inadequate for allowing these sectors to catch up with international production standards.
Without a massive and collectively shared adjustment and compensation strategy, the EPAs could severely weaken the vulnerable economies of many African countries.
Policy Implications
The African partner countries face the challenge of diversifying their economies and tackling capacity and infrastructure constraints. The EU, in turn, will need to translate its vague promise to support both trade and development in Africa into clear and effective support measures. Both aspects are essential to facilitating mutually beneficial trade liberalisation and confronting potential adverse effects.
Afrika im Spannungsfeld des multilateralen Handelssystems
Die Frage, ob Handelsliberalisierung und Integration in die Weltwirtschaft zu Wachstumsimpulsen, mehr Wohlstand und weniger Armut in allen beteiligten Ländern beiträgt, wird seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Genau wie das Tauziehen um Mega-Freihandelsprojekte wie das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) haben die Verhandlungen um die Neuordnung der Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Subsahara-Afrika (SSA) hin zu WTO-konformen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen – den Economic Partnership Agreements (EPAs) – zu einer neu entfachten und polarisierenden Debatte darüber geführt.
Handel zwischen ungleichen Partnern
Durch die Lomé-Abkommen (1975-2000) wurde den Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP-Staaten) der quoten- und zollfreie Zugang zum EU-Markt gewährt, ohne dass sie selbst ihre Märkte zu öffnen brauchten. Da diese Sonderbehandlung gegenüber anderen Entwicklungsländern nicht mit den Prinzipien der WTO vereinbar war (eine letztmalige Ausnahmegenehmigung ist im Jahr 2007 abgelaufen), enthält das Folgeabkommen von Cotonou (2000-2020) die Zielsetzung, die EPAs als reziproke Freihandelsabkommen zu etablieren.
Bei Nichtabschluss würden die Länder Afrikas mit oberem mittlerem Einkommen unter das Meistbegünstigungsprinzip (MFN) der WTO fallen, während Länder mit geringem oder niedrigem mittlerem Einkommen über das Allgemeine Präferenzsystem (GSP) auf Zweidrittel der Tarifposten Vergünstigungen bis hin zur Zollfreiheit erhalten könnten. Lediglich die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed Countries, LDCs) erhielten unter der im Jahr 2001 für alle LDCs eingeführten „Everything But Arms“ (EBA)-Initiative auch ohne EPA weiterhin einseitig freien Zugang zum EU-Markt.
Liberale Befürworter werden nicht müde, die Vorzüge von Freihandelsabkommen wie den EPAs zu betonen: Größere Märkte böten neue Absatzchancen, internationaler Wettbewerb steigere die Effizienz, Skaleneffekte ermöglichten niedrigere Stückkosten, eine weltweite Arbeitsteilung und Spezialisierung optimierten die Produktion; Produzenten und Konsumenten gewännen. Die EU lockt außerdem mit dem verbesserten Zugang zu ausländischen Investitionen und neuen Technologien.
Auch die meisten afrikanischen Länder erkennen die Notwendigkeit, über den Tellerrand ihrer oft schwach entwickelten Binnenmärkte zu schauen. So überrascht es kaum, dass fast alle Länder SSAs inzwischen der Welthandelsorganisation (WTO) beigetreten sind und dort ein Viertel aller Mitglieder stellen. De facto ist die Rechnung für die Staaten südlich der Sahara jedoch bislang kaum aufgegangen. Die lange vorherrschende Annahme, dass sie ihren Standortvorteil nutzen und sich auf den Export von Rohstoffen, Agrargütern und arbeitsintensiver Produkte spezialisieren sollten, ist der Erkenntnis gewichen, dass diese Strategie kaum langfristige Perspektiven bietet, um den Teufelskreis breiter Armut, Beschäftigungslosigkeit und wirtschaftlicher Abhängigkeit zu durchbrechen. Bezeichnend ist auch, dass SSA allen komparativen Vorteilen zum Trotz die einzige Region ist, deren Anteile am Weltagrarhandel seit Gründung der WTO gefallen sind. Auch in anderen Bereichen wird die Region als kaum international wettbewerbsfähig eingestuft (Schwab 2016).
Für viele Länder SSAs hat sich mit der Ankündigung der EU, die wechselseitigen Handelsbeziehungen auf eine WTO-konforme Ebene stellen zu wollen, das Gefühl, sich im Würgegriff der Industrieländer zu befinden, noch verstärkt. Während die EU die Vorteile der Abkommen für die Entwicklung Afrikas herausstellt, herrscht in den Partnerländern im öffentlichen Diskurs die Meinung vor, dass die Afrikaner – trotz der versprochenen Entwicklungsförderung der EU – in den Verhandlungen über den Tisch gezogen werden. Sie sehen die Abkommen als Ausdruck der Vorherrschaft europäischer Wirtschaftsinteressen und fürchten sogar eine wirtschaftliche Rückentwicklung, sollten sie ihre Märkte uneingeschränkt für (subventionierte und technologisch überlegene) europäische Produkte öffnen. Auch wird die erpresserische Verhandlungsführung der EU kritisiert und deren wahre Ziele infrage gestellt.
In der mitunter emotional aufgeheizten und mit harten Bandagen geführten Auseinandersetzung um die Freihandelsabkommen zwischen der EU und Afrika bleiben die wahrscheinlichen Auswirkungen derartiger Liberalisierungsprozesse heftig umstritten – nicht zuletzt, weil es bisher an konkreten Erfahrungen und einer soliden Datenbasis zur Einschätzung ihrer tatsächlichen Folgen fehlt. Klar ist, dass die Abkommen sowohl Chancen als auch Risiken bergen. Fraglich ist, ob der Nutzen den möglichen Schaden überwiegen kann.
Um dieser Frage nachzugehen, gilt es zunächst, Klarheit bezüglich der tatsächlichen internationalen Handelsintegration Afrikas einerseits und dem aktuellen Stand der teilweise unübersichtlichen handelspolitischen Verhandlungen und der darin getroffenen Vereinbarungen andererseits zu schaffen. Auf dieser Grundlage beschäftigen uns im Folgenden vier Kernfragen: Welche Veränderungen ergeben sich für afrikanische Länder aus WTO-konformen Freihandelsabkommen? Entlang welcher Transmissionskanäle entstehen positive und negative Auswirkungen? Welche Rolle spielen dabei Veränderungen des internationalen Handelssystems, beispielsweise hin zu der Vereinbarung mega-regionaler Abkommen? Unter welchen Bedingungen können die Abkommen positive Entwicklungsimpulse in Afrika setzen?
Afrikas Handelsintegration in der Welt
Die Befürchtung, dass SSA in naher Zukunft wenig von seiner zunehmenden Handelsöffnung profitieren wird, liegt zum einen in seiner seit der Kolonialzeit praktisch unveränderten Rolle als Rohstofflieferant begründet, die mit geringen Möglichkeiten der Wertschöpfung und Wohlstandsgenerierung und einer hohen Vulnerabilität gegenüber Preisschwankungen einhergeht. Zum anderen ist der Anteil Afrikas am globalen Exporthandel, wenn auch im Trend steigend, mit gegenwärtigen 2,4 Prozent für Afrika insgesamt und 1,7 Prozent für Afrika südlich der Sahara nach wie vor extrem gering.
Abbildung 1 verdeutlicht, dass der Hauptanteil des Güterexports aus Brennstoffen, Erzen und Metallen besteht, gefolgt von anderen Primärgütern. Dabei mussten vor allem ölexportierende Länder (insbesondere Angola, Äquatorial Guinea, Nigeria, Republik Kongo, Sudan und Tschad), die für insgesamt 50 Prozent des Gesamtexports der Region verantwortlich sind, in den vergangenen Jahren deutliche Verluste hinnehmen. Der Grund liegt in drastischen Ölpreisschocks durch ein gestiegenes Angebot (z.B. durch neue Technologien der Ölförderung wie Fracking in den Vereinigten Staaten) und geringere Nachfrage (z.B. durch das sich nur langsam von der Finanzkrise erholende Europa und Wachstumseinbrüche in China). Hinzu kommen eine starke Aufwertung des US-Dollars sowie damit einhergehenden Zinserhöhungen und entsprechende Verlagerungen ausländischer Investitionen weg vom Rohstoffhandel. Wenngleich nicht im selben Maß wie Öl, waren auch andere Rohstoffe (z.B. Erze und Metalle, aber auch nichtextraktive Rohstoffe wie Baumwolle und Gummi) von sinkenden Preisen betroffen. Dadurch wurde in vielen Ländern leider auch der Gewinn durch billigere Ölimporte direkt wieder abgeschwächt. Der Verlust von Steuereinnahmen durch Exporteinbußen ist jedoch in den ölexportierenden Ländern deutlich höher, da diese (außer in Kamerun) typischerweise über 80 Prozent der gesamten Exporteinnahmen ausmachen (Weltbank 2015a).
Der geringe Anteil an Industriegütern wird hauptsächlich innerhalb der Region gehandelt. Viele afrikanische Länder haben in den letzten Jahren ihr Augenmerk wieder stärker auf die regionale Wirtschaftsintegration gerichtet, sichtbar beispielsweise an den Überlegungen zu einer „Continental Free Trade Area“ (CFTA), der „Tripartite Free Trade Area“ (TFTA) in Ostafrika oder der Umsetzung des „Common External Tariff“ (CET) in Westafrika. Dennoch ist das Volumen des interregionalen Handels, wenngleich steigend, deutlich geringer als das, welches auf die Haupthandelspartner Asien und die EU entfällt. Der Anteil des intraregionalen Handels am Gesamthandel liegt in SSA bei unter 20 Prozent, während er in Asien und der EU etwa die Hälfte des Gesamthandels ausmacht. Dies liegt vor allem an sehr hohen Transaktionskosten (z.B. Transportkosten und Zöllen). Im Handel mit dem Rest der Welt kämpft SSA insgesamt mit einem deutlichen Abwärtstrend der Terms-of-Trade (ToT), also dem realen Austauschverhältnis von Importen und Exporten. Diese verschlechterten sich für SSA im Jahr 2015 um fast 20 Prozent. In den ölexportierenden Ländern wird der Verlust aufgrund des starken Preisverfalls sogar auf 40 Prozent geschätzt (Weltbank 2015a).

Was den Handel mit Dienstleistungen betrifft, so konnte die Gruppe der LDCs ihren Anteil am Welthandel in der letzten Dekade steigern. Dieser Erfolg speist sich jedoch vor allem aus Dienstleistungsexporten der asiatischen Länder, insbesondere von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen. SSAs Anteil hingegen beläuft sich auf nur 2 Prozent.
Aus Abbildung 1 wird ebenfalls ersichtlich, dass Asien (und insbesondere China) die EU als größten Handelspartner der Region abgelöst hat. Dies ist bereits seit dem Jahr 2009 der Fall, mit steigender Tendenz. Derzeit gehen 36 Prozent aller Exporte SSAs nach Asien (wovon 81 Prozent auf China entfallen) und 26 Prozent in die EU (UNCTAD 2015). Die größten „Händler“ innerhalb SSAs (gemessen am Außenhandelsvolumen) sind seit Jahren Südafrika und Nigeria.
Trotz langjähriger einseitiger Handelspräferenzen, welche die wichtigsten Handelspartner SSA einräumen, erwirtschaften nur wenige Länder einen Außenhandelsüberschuss. Hierzu zählt Côte d’Ivoire (dessen Wirtschaft sich gerade sprunghaft von den Bürgerkriegsfolgen erholt) mit 45 Prozent Export- versus 42 Prozent Importanteil am BIP, was in etwa der Situation in Deutschland entspricht (46 versus 39 Prozent) (Weltbank 2015b). Dem gegenüber stehen Extremfälle wie Liberia, wo der Wert der Importe fast 90 Prozent des BIP entspricht, während der Exportanteil nur bei 23,5 Prozent liegt. Der größte Anteil der Importe SSAs kommt aus Asien, insbesondere aus China (20 Prozent der Gesamtimporte im Jahr 2015), und umfasst vor allem Produkte aus der Kategorie Maschinen und Transportzubehör, aber auch andere Fertiggüter wie Textilien und Büromaterialien, sowie chemische Erzeugnisse. Sowohl aus Asien, als auch aus Europa wird jedoch auch ein nicht unerheblicher Anteil an Brennstoffen und Agrarprodukten importiert (etwa 30 Prozent der Gesamtimporte) also Güter, in denen eigentlich viele Länder in SSA komparative Handelsvorteile besäßen.
Während der Außenhandel mit der EU für die afrikanischen Länder einen entscheidenden wirtschaftlichen Beitrag leistet, ist Afrika für die EU als Handelspartner von vergleichsweise geringer Bedeutung. Entsprechend groß ist der Druck, der auf den afrikanischen Volkswirtschaften lastet, sich auch in Zukunft den präferenziellen Zugang zum europäischen Markt zu sichern.
EU-Afrika: Das Kräftezerren um die Bedingungen einer ungleichen Partnerschaft
Für die Verhandlungen um die EPAs wurden sieben Subregionen definiert: Ostafrika (EAC), Südostafrika (ESA), Südliches Afrika (SADC-Gruppe), Westafrika (ECOWAS + Mauretanien), Zentralafrika, Karibik, sowie Pazifik (siehe Abbildung 2 oben rechts für die fünf Gruppen in SSA). Trotz der asymmetrischen Beziehung zur EU haben sich die afrikanischen Länder als harte Verhandlungspartner in dem seit dem Jahr 2003 andauernden Tauziehen um die in den EPAs festgehaltenen Bestimmungen erwiesen. Bis Anfang des Jahres 2008 war es nur gelungen, ein umfassendes EPA mit den 13 karibischen CARIFORUM-Staaten abzuschließen. Ein gesondertes Abkommen über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit (TDCA) der EU mit Südafrika trat außerdem im Mai 2004 in Kraft.
Nach langer Blockade in den Verhandlungen erhöhte die EU im Jahr 2014 den Druck auf die AKP-Staaten: Sie drohte allen Ländern oder Regionen, die bis zum 1. Oktober 2014 kein EPA ratifiziert hätten, den durch eine Übergangsregelung (die sogenannte Market Access Regulation, MAR 1528/2007) zeitlich begrenzt fortgeschriebenen einseitigen freien Marktzugang zu entziehen und den Regeln des WTO-konformen GSP-Systems zu unterstellen. Damit gerieten speziell die Nicht-LDCs in Bedrängnis, die einem EPA bereits zugestimmt, dieses jedoch noch nicht unterzeichnet oder ratifiziert hatten (siehe Abbildung 2 linkes Panel).

Durch diese Drohung kamen die Verhandlungen neu ins Rollen:
In der SADC-Gruppe wurde Mitte Juli 2014 eine Einigung mit Botswana, Lesotho, Namibia, Swasiland, Südafrika, die zusammen die Südafrikanische Zollunion (SACU) bilden, und Mosambik erzielt. Das Abkommen wurde am 10. Juni 2016 unterzeichnet und wird seit dem 10. Oktober 2016 vorläufig angewendet. Es ist damit das erste in Kraft getretene regionale EPA. Angola, das siebte Land der SADC-EPA-Gruppe bleibt zunächst Teil der EBA-Initiative, kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt beitreten.
Mit den Staaten der ESA-Gruppe wird seit dem 14. Mai 2012 ein Interim-EPA vorläufig angewendet. Die beteiligten Länder erhalten damit uneingeschränkten Zugang zum EU-Markt (mit einer Übergangsperiode für Reis und Zucker) mit verbesserten Ursprungsregeln und sind im Gegenzug verpflichtet, ihren Markt schrittweise innerhalb von 15 Jahren für die EU zu öffnen (Seychellen zu 98 Prozent, Mauritius zu 96 Prozent, Madagaskar zu 81 Prozent, Simbabwe zu 80 Prozent). Sambia und die Komoren hatten dem Vertragstext im Jahr 2007 vorläufig zugestimmt, eine Unterschrift blieb jedoch aus. Sie erhalten damit, wie die anderen Niedrigeinkommensländer der Region, weiterhin freien EBA-Marktzugang. Das letzte Verhandlungstreffen über ein finales EPA fand im Jahr 2011 statt.
In der ECOWAS-Gruppe traf die Drohung der EU im Jahr 2014 insbesondere Côte d’Ivoire und Ghana, die keinen LDC-Status haben und zu diesem Zeitpunkt bilaterale Interim-EPAs ausgehandelt, aber nicht ratifiziert hatten. Die anderen beiden Nicht-LDCs Nigeria und Kap Verde fielen hingegen bereits seit Längerem unter das GSP beziehungsweise GSP+-System. Gleichwohl gerieten auch die zwölf LDC-Länder unter Druck. Als Teil der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft wäre eine Unterzeichnung des EPA durch einige der Nicht-LDCs einer indirekten Öffnung für zollbegünstigte EU-Produkte in der gesamten Region gleichgekommen. Somit hätten Kontrollen aufgebaut oder verstärkt werden müssen (Lohmann 2015). Um den Prozess der regionalen Integration nicht zu gefährden, wurde im Juni 2014 nach Jahren des Widerstandes vieler westafrikanischer Länder der Vertragstext des EPA vorläufig anerkannt. Nichtsdestotrotz blieben die Positionen der Staats- und Regierungschefs in der Region gespalten. So erhält das Abkommen deutlichen Zuspruch durch Côte d’Ivoire als stark exportorientierte Wirtschaft mit der EU als Haupthandelspartner, während es insbesondere von Nigeria vehement abgelehnt wird. Laut Informationen von Financial Vanguard (Alli und Uzor 2016) hatten mit Ablauf der gesetzten Frist am 1. Oktober 2016 mit Ausnahme von Nigeria, Liberia, Sierra Leone und Gambia die nationalen Parlamente von 12 der 16 ECOWAS Länder das Abkommen ratifiziert, womit die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht wäre. Im August ratifiziert wurden zudem die bilateralen Interim-EPAs der EU mit Côte d’Ivoire und Ghana, die jetzt vorläufig Anwendung finden.
Die Verhandlungen der EU mit der EAC-Gruppe über ein regionales EPA wurden im Oktober 2014 abgeschlossen, die Unterzeichnung des Abkommens gestaltet sich jedoch kompliziert. Für Tansania, das erste Land, das seine Bedenken zum Ausdruck brachte, hat das Abkommen durch den Brexit (75 Prozent der Exporte des Landes gehen an das Vereinigte Königreich) deutlich an Attraktivität verloren. Uganda zog mit dem Argument nach, dass die EPA-Bestimmungen inzwischen einen Grad der Komplexität erreicht hätten, der eine Unterzeichnung durch die Staatsoberhäupter der Länder und nicht nur durch die Minister erfordere (Lorenz 2016). Während Tansania, Burundi, Uganda, und Ruanda als LDCs unter der fortbestehenden EBA-Initiative weiterhin zollfrei in die EU exportieren, geriet vor allem Kenia als einziges Nicht-LDC in die Bredouille, denn die EU ist eine der Kernzielregionen kenianischer Agrarexporte. Die zeitweise eingeführten Strafzölle auf Blumen und Bohnen aus Kenia trafen das Land so hart, dass die kenianische Regierung ihren Widerstand gegen das EPA schließlich aufgab und das Abkommen im September 2016 gemeinsam mit Ruanda ratifizierte.
In der Gruppe Zentralafrika wurde bislang nur ein Interim-EPA mit Kamerun beschlossen, dass im Juli 2014 ratifiziert wurde und seit dem 4. August 2014 vorläufig angewendet wird. Kamerun wird darin verpflichtet, über einen bis zum Jahr 2023 vorgesehenen Übergangszeitraum seinen Markt für 80 Prozent der EU-Importe zu liberalisieren. Nichtregierungsorganisationen kritisieren, dass das Abkommen nur unter der Androhung des Entzugs von Geldern aus dem Europäischen Entwicklungsfonds (EDF) zustande gekommen sei. Die beiden anderen Nicht-LDCs der Region, Gabun und die Republik Kongo, haben bislang kein EPA unterzeichnet. Während die Republik Kongo unter das GSP System fällt, untersteht Gabun als Mitteleinkommensland seit dem Jahr 2014 dem MFN-Prinzip. Die übrigen Länder der Region erhalten weiterhin quoten- und zollfreien Zugang zum EU-Markt über die EBA-Initiative. Ein regionales Abkommen ist bislang nicht in Sicht und die anderen Staaten der Region missbilligen Kameruns Alleingang. Das Abkommen beeinträchtigt somit den regionalen Integrationsprozess; zum Beispiel hat Gabun den freien Verkehr von Waren und Personen mit Kamerun anschließend aufgehoben.
Freihandel als Entwicklungsstrategie versus Manifestation bestehender Abhängigkeiten
Der lange Verhandlungsmarathon um die Bedingungen der ungleichen Partnerschaft zwischen den Ländern des südlichen Afrikas und Europas ist nicht nur das Resultat widersprüchlicher Interessen, sondern auch Ausdruck großer Unsicherheit, denn bislang lassen sich die Konsequenzen, die eine Öffnung der afrikanische Ökonomien für Importe aus Europe vorsehen, nur schwer abschätzen. Mögliche Auswirkungen ergeben sich vor allem entlang der folgenden Kanäle:
Exportsektor: Die Erhaltung des präferenziellen Marktzugangs ist vielerorts von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung, dessen Entzug den Verlust einer wichtigen Einkommensquelle und zahlreicher Arbeitsplätze nach sich ziehen würde. Auch auf Seiten der Staatseinnahmen spielen Exportsteuern auf Rohstoffe eine wichtige Rolle. Entgegen der ursprünglichen Forderung der EU, diese abzuschaffen, konnten sich die afrikanischen Länder in diesem Punkt durchsetzen. Kommt es zu einer Unterzeichnung der EPAs, so dürfen diese auch in Zukunft erhoben werden. Einen Vorteil gegenüber dem Status quo könnten die in den EPAs vorgesehenen kumulativen Ursprungsregeln bieten. Diese sehen den zollfreien Export von Erzeugnissen vor, die aus verschiedenen in der Region produzierten Teilprodukten zusammengesetzt sind.
Importsektor: Aktuell erheben die Länder südlich der Sahara Importzölle von rund 15 Prozent auf Agrarprodukte und 8 Prozent auf Industrieprodukte aus der EU, in Zentralafrika und den ESA-Staaten sogar mehr. Die höchsten Einfuhrzölle werden auf weiterverarbeitete Lebensmittel und Textilien angewendet. Darüber hinaus sind die Zölle auf Gemüse, Viehzucht und Produkte der Leicht- sowie metallverarbeitenden Industrie relativ hoch (vgl. GTAP 8 Data Base). Unter Anwendung der EPAs könnten nur etwa ein Fünftel dieser Tarifposten bestehen bleiben. Die Konsumenten könnten von günstigeren Importprodukten profitieren. Dem entgegen stehen aber vier zentrale potenzielle Nachteile:
Strukturwandel: Eine große Befürchtung besteht darin, dass sich die ohnehin geringe afrikanische Industrieproduktion wieder zurückentwickelt, da diese bislang nicht im freien Wettbewerb mit Europa bestehen könnte (zum Beispiel aufgrund von höheren technologischen Standards und Skaleneffekten). Liberalisierungsbefürworter hingegen sehen den durch die Öffnung geschaffenen Wettbewerb als Chance, um Ineffizienzen zu beseitigen und die afrikanische Industrie an internationale Standards heranzuführen. Die vorgesehene Übergangsperiode von 15 bis 20 Jahren erscheint in dieser Hinsicht jedoch utopisch.
Agrarsubventionen: Eine zweite Befürchtung der Afrikaner liegt in der Zerstörung heimischer Märkte und Wettbewerbsverzerrung, die durch die Einfuhr subventionierter Agrarprodukte aus der EU entstehen könnten (Kappel 2016). Das am häufigsten angeführte Beispiel in diesem Zusammenhang sind die EU-Exporte von hochsubventionierten Hühnchen nach Westafrika, die in der Vergangenheit zahlreiche lokale Geflügelbauern in den Ruin getrieben haben sollen. Es fehlt das Vertrauen in die Zusicherung der EU, keine subventionierten Agrarprodukte nach Afrika zu exportieren.
Importzölle: Fiskalpolitisch steht der Verlust von Importzolleinnahmen scharf in der Kritik. Diese machen je nach Land 10 bis 30 Prozent der Staatseinnahmen aus. Ihr Wegfall müsste demnach durch eine drastische Anpassung des Steuersystems kompensiert werden. Dies stellt afrikanische Länder vor enorme Herausforderungen, da das Steuerwesen als einer der korruptesten Bereiche der staatlichen Verwaltung gilt und ein großer Teil der Wirtschaftstätigkeit im informellen Sektor stattfindet.
Handelsbedingungen innerhalb und außerhalb der Region: Ursprünglich vorgesehen war, dass die Marktöffnung gegenüber der EU wechselseitig für alle Handelspartner in der jeweiligen EPA-Region gilt und so die regionale Integration fördern sollte. Die regionalen Integrationsklauseln werden allerdings nicht immer durchgesetzt, wie die Erfahrungen des CARIFORUM-EPAs zeigen, da viele Länder die regionale Konkurrenz noch mehr fürchten als die EU-Importe (Schmieg 2016). Hinzu kommt, dass ein Abschluss der EPAs mit einzelnen Ländern, wie im Fall Kameruns, zu einer Isolation dieses Landes in der Region führen und so der regionalen Integration entgegenwirken könnte. Länder wie Nigeria betonen zudem den in Folge erschwerten Abschluss von Handelsabkommen mit anderen Partnern wie China und Indien, denen unter Beachtung des MFN-Prinzips die gleichen Handelspräferenzen eingeräumt werden müssten, wie der EU (Lohmann 2015).
Dienstleistungen und Investitionen: Das ursprüngliche Mandat der EU im Rahmen der EPA-Verhandlungen sah vor, neben dem Güterhandel auch Regelungen zum Handel mit Dienstleistungen, zu Investitionen, zum Schutz geistiger Eigentumsrechte, zur Wettbewerbspolitik, zur Öffentlichen Beschaffung und zur Harmonisierung nichttechnischer Standards (z.B. im Umweltschutz) in die Abkommen aufzunehmen (Asche 2015). Während das CARIFORUM-EPA solche Bestimmungen zur „Tiefenintegration“ enthält, konnte in den Verhandlungen mit SSA aufgrund des vehementen Widerstandes der afrikanischen Regierungen (ähnlich wie bereits auf WTO-Ebene im Rahmen der Doha-Runde) keine Einigung erzielt werden. Die angedachten Bestimmungen sind daher einer sogenannten „Rendezvous-Klausel“ gewichen und sollen später nachverhandelt werden. Einer Übereinkunft standen bislang die hohe Komplexität der Abkommen und ihre kaum abschätzbaren Folgen entgegen. Besonders fürchten die afrikanischen Regierungen, dass die Liberalisierung von Dienstleistungsimporten (u.a. durch ausländische Direktinvestitionen in Bereichen wie der Wasser- und Energieversorgung, aber auch Bildung und Gesundheit) den eigenen politischen Handlungsspielraum einschränken könnte.
Entwicklungszusammenarbeit: Neben der handelspolitischen Neuregelung geht es bei den Abkommen auch um eine Fortschreibung der europäischen Entwicklungspolitik mit den AKP-Staaten. Hier kollidiert das generell begrüßenswerte Ziel einer Kooperation auf Augenhöhe mit der Realität einer ungleichen Partnerschaft. Klar ist, dass der steigende Konkurrenzdruck allein das seit Langem bestehende Problem unausgereifter und ineffizienter Produktionsverfahren kaum lösen kann. Um administrative, kapazitätsbezogene und infrastrukturelle Probleme richtig angehen zu können, erwarten afrikanische Regierungen verbindliche Zusagen der EU. Sie betonen die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzhilfen, mit denen die erheblichen Anpassungskosten im Zuge der Handelsliberalisierung abgefedert und entgangene Zolleinnahmen kompensiert werden sollen. Die EU hingegen sieht ihre Plicht bereits durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Europäischen Entwicklungsfonds und das im Cotonou-Abkommen vereinbarte „Aid for Trade“-Programm erfüllt.
Afrikas Handelsintegration mit der EU im internationalen Kontext
Neben den Effekten einer direkten Handelsintegration mit der EU lassen sich auch indirekte Effekte durch die derzeit verhandelten mega-regionalen Freihandelsabkommen auf Afrika erwarten. Die USA verhandeln aktuell mit Japan, Kanada, Australien und acht weiteren Staaten die „Trans-Pacific Partnership“ (TPP) sowie die „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP) mit der EU. Auf der anderen Seite verhandelt China mit einer Reihe von asiatischen Ländern die „Regional Comprehensive Economic Partnership“ (RCEP) sowie die „Free Trade Area of the Asia Pacific“ (FTAAP), die sich allerdings noch in einer frühen Planungsphase befindet.
Die Vertragsparteien in Asien, der EU und den USA hoffen so ihre Handelsbeziehungen untereinander auszuweiten – oft auf Kosten des Handels mit Ländern außerhalb der Handelszonen. Profitieren könnten die Länder Afrikas trotzdem dann, wenn mit den durch die Abkommen entstehenden internen Einkommens- und Produktionszuwächse auch die Nachfrage nach Exportgütern aus Drittländern stiege. Jüngste Studien kommen jedoch zu dem Schluss, dass westliche Abkommen wie TTIP und TPP eher geringe Effekte auf das Einkommensniveau afrikanischer Länder hätten, da sich negative Handelsumlenkungseffekte und positive Einkommenseffekte mehr oder weniger ausglichen (Putzhammer, Felbermayr und Aichele 2016). Hingegen könnten von FTAAP erhebliche positive Effekte ausgehen, wenn mit der Vertiefung der Handelsbeziehungen Chinas auch die chinesische Nachfrage nach afrikanischen Rohstoffen weiter stiege. Während der Agrarsektor mit einem Einbruch der Wertschöpfung aufgrund von Handelsumlenkungseffekten rechnen müsste, wäre es möglich, dass dieser Effekt durch die positiven Einkommenseffekte im Bergbau und anderen Rohstoffsektoren überkompensiert würde. Neben Südafrika könnte so beispielsweise auch Mosambik, eines der ärmsten Länder Afrikas, profitieren, da chinesische Produzenten eine hohe Nachfrage nach den dort vorhandenen Rohstoffen, Metallen (insbesondere Aluminiumvorräte) und Mineralien aufweisen (Putzhammer, Felbermayr und Aichele 2016).
Allerdings ist es mehr als fraglich, ob die Dependenz von Rohstoffexporten der afrikanischen Länder weiter fortgeschrieben werden sollte, oder besser Möglichkeiten geschaffen werden, die die globale Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder langfristig steigern. Dazu beitragen könnte grundsätzlich die Harmonisierung von Produktstandards (z.B. beim Umwelt- und Verbraucherschutz) im Zuge der Ratifizierung mega-regionaler Abkommen, die auch den Warenverkehr mit Drittländern vereinfachen könnten (Schmieg 2016). Gleichzeitig stellt die Erfüllung dieser Standards insbesondere für arme Länder mit häufig schwachen Institutionen und unzureichender Qualitätsinfrastruktur eine erhebliche Herausforderung dar. So wird es beispielsweise mosambikanischen Fischern kaum möglich sein, die von der EU oder den USA festgelegten Kriterien zur Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit zu erfüllen (Putzhammer, Felbermayr und Aichele 2016). Sollte den afrikanischen Produzenten eine Anpassung nicht gelingen, werden sie aus den Märkten verdrängt werden.
Diskussion und Ausblick
Die Liste an Vorteilen, welche die EU durch die EPAs in Aussicht stellt, steht in starker Diskrepanz zu den dargestellten Befürchtungen der afrikanischen Handelspartner und Sorgen zivilgesellschaftlicher Akteure über die Auswirkungen einer raschen Öffnung der schwachen afrikanischen Märkte und die damit einhergehenden strukturellen Anpassungen. Klar ist, dass der grenzüberschreitende Handel in jedem Land nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer schaffen wird.
Im klassischen Handelsmodell gestaltet sich dieser Wandel unproblematisch: Die Verlierer wandern ab in die Wirtschaftszweige, in denen das Land einen komparativen Vorteil genießt, oder werden durch die Gewinner kompensiert. In der Praxis wird es hingegen nur mittels umfassender, strukturpolitischer Reformen und Qualifizierungsmaßnahmen gelingen, die Abgehängten am sozialen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen. Für den dafür notwendigen Aufbau funktionierender sozialer Sicherungs- und Steuersysteme fehlen vielen Ländern die Kapazitäten. Auch von Seiten der EU gibt es keinen klaren Fahrplan, wie sie die AKP-Staaten bei der Umsetzung solcher Maßnahmen unterstützen können.
Schwerer noch wiegt die Unsicherheit darüber, in welche Richtung der handelsinduzierte Strukturwandel durch die EPAs und mögliche Folgeliberalisierungen insgesamt gehen wird. Einerseits fühlen sich die afrikanischen Länder ihrer Chance beraubt, international wettbewerbsfähige Industrien im Schutz von Handelsbarrieren aufzubauen und sehen sich für eine Öffnung noch nicht bereit. Andererseits produzieren sie auch 40 Jahre nach dem ersten Lomé-Abkommen trotz präferenzieller Schutzmaßnahmen kaum konkurrenzfähige Waren und liefern vor allem nicht, oder nur wenig weiterverarbeitete Rohstoffe in den Rest der Welt.
Eine Neuordnung scheint unausweichlich, denn sollten die Länder SSAs es nicht schaffen, ihre Industrien auf internationale Standards zu heben, so werden sie auch im Handel mit Asien nicht über die Rolle des Lieferanten billiger Rohstoffe hinauskommen. Christophe De Vroey, Kenia-Beauftragter der EU in den Bereichen Handel und Kommunikation, machte diesen Punkt kürzlich besonders deutlich: „Es bestehen Sorgen über die mögliche Einfuhr landwirtschaftlicher Güter aus der EU? Es sollte sich eher Sorgen über die riesige Menge an Fertiggütern, die auf Kosten der lokalen Hersteller aus Indien und China importiert werden, gemacht werden. Dies passiert gegenwärtig ganz ohne Handelsliberalisierung” (EEAS 2015). Die afrikanischen Länder sollten den richtigen Zeitpunkt für die vollständige Öffnung ihrer Märkte selbst bestimmen können. Die Abkommen mit der EU sind dabei richtungsweisend, da sie auch ihren Verhandlungsspielraum mit den asiatischen Ländern unter Beachtung des MFN-Prinzips deutlich schmälern könnten.
Footnotes
References
Alli, Franklin, und Naomi Uzor (2016), EU Threatens to Stop Market Access for Nigerian Products over EPA, www.vanguardngr.com/2016/10/eu-threatens-stop-market-access-nigerian-products-epa/ (24. November 2016).
Asche, Helmut (2015), Europa, Afrika und der Transatlantik – Die Nord-Süd-Herausforderung für entwicklungsorientierte Handelspolitik, Internationale Politik, E-Paper, Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, www.boell.de/sites/default/files/web_151020_e-paper_eruopa_afrika_transatlantik_v102_1.pdf (24. November 2016).
ECDPM (n.d.), Dossier: FAQ – Economic Partnership Agreements, http://ecdpm.org/dossiers/dossier-economic-partnership-agreements/# (29. November 2016).
EEAS (European Union External Action Service) (2015), Trade between the EU and Kenya, Information of the EAC-EU Economic Partnership Agreement, April Edition, http://eeas.europa.eu/archives/delegations/kenya/documents/press_corner/trade_between_the_eu_and_kenya_2105.pdf (29. November 2016).
GTAP 8 Data Base, www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v8/ (9. Dezember 2016).
Kappel, Robert (2016), Kooperation mit Afrika auf neue Beine stellen, International Development Blog, http://blogs.die-gdi.de/2016/11/21/kooperation-mit-afrika-auf-neue-beine-stellen/ (24. November 2016).
Lohmann, Annette (2015), Impuls oder Hindernis für Entwicklung? Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und Westafrika, Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Afrika.
Lorenz, Ama (2016), Streit über EU-Handelsabkommen mit Ostafrika, EurActiv, www.euractiv.de/section/entwicklungspolitik/news/streit-ueber-eu-handelsabkommen-mit-ostafrika/ (8. Dezember 2016).
Putzhammer, Fritz, Gabriel Felbermayr und Rahel Aichele (2016), The Forgotten Continent – The Effects of Mega-Regional Free Trade Agreements on Africa, Part 3 of the GED Study Series: Effects of Regional Trade Agreements, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
Schmieg, Evita (2016), Handelspolitische Optionen für Subsahara-Afrika – Zwischen TTIP, EPAs, WTO und afrikanischer Integration, SWP-Aktuell 2015/A 35.
Schwab, Klaus (2016), The Global Competitiveness Report 2016-2017, Genf: World Economic Forum.
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2015), UNCTADstat, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/ reportfolders.aspx (29. November 2016).
Weltbank (2015a), Africa’s Pulse, An Analysis of Issues Shaping Africa’s Economic Future, 11/2015 Document produced by the Office of the Chief Economist for the Africa region, www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Report/Africas-Pulse-brochure_Vol11.pdf (29. November 2016).
Weltbank (2015b), World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators (29. November 2016).
General Editor GIGA Focus
Editor GIGA Focus Africa
Editorial Department GIGA Focus Africa
Regional Institutes
Research Programmes
How to cite this article
Giesbert, Lena, Birte Pfeiffer, and Simone Schotte (2016), Economic Partnership Agreements with the EU: Trade-Offs for Africa, GIGA Focus Africa, 7, Hamburg: German Institute for Global and Area Studies (GIGA), http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-49908-0
Imprint
The GIGA Focus is an Open Access publication and can be read on the Internet and downloaded free of charge at www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus. According to the conditions of the Creative-Commons license Attribution-No Derivative Works 3.0, this publication may be freely duplicated, circulated, and made accessible to the public. The particular conditions include the correct indication of the initial publication as GIGA Focus and no changes in or abbreviation of texts.
The German Institute for Global and Area Studies (GIGA) – Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg publishes the Focus series on Africa, Asia, Latin America, the Middle East and global issues. The GIGA Focus is edited and published by the GIGA. The views and opinions expressed are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of the institute. Authors alone are responsible for the content of their articles. GIGA and the authors cannot be held liable for any errors and omissions, or for any consequences arising from the use of the information provided.