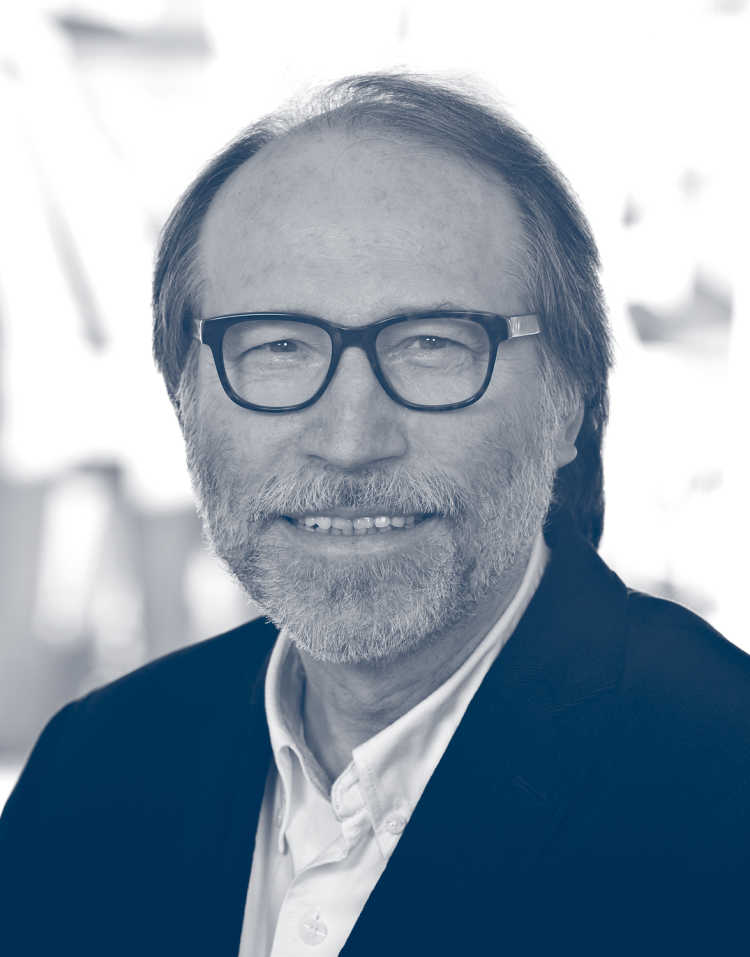- Home
- Publications
- GIGA Focus
- Donald Trump und das außenpolitische Erbe von Barack Obama
GIGA Focus Global
Donald Trump and the Foreign Policy Legacy of Barack Obama
Number 7 | 2016 | ISSN: 1862-3581

President Barack Obama’s restrained foreign policy has focused on key national interests while also contributing to the stabilisation of the international order. However, the election of Donald Trump as the forty-fifth president of the USA has raised fears that the cornerstones of the liberal world order could be eroded and that uncontrollable dynamics could be set in motion in various world regions.
As the first “Pacific president,” Obama has broadened numerous alliances with Asia and consolidated the USA’s role as a security policy leader. It is precisely this role that is being called into question by President-elect Trump. Should the USA no longer function as a pillar of the regional security order, arms races and the escalation of existing tensions could result.
In the Middle East, Obama has refrained from military interventions and made an effort towards reconciliation with the Islamic world. Yet since his hopes of democratisation as a result of the Arab Spring failed to materialise, his interest in playing a shaping role has declined noticeably. The view now is that the states in the region should take on more responsibility themselves in future. Donald Trump will reinforce this approach – backtracking, however, in individual cases.
In Africa, the USA has lost political influence during Obama’s tenure, while it has expanded economic relations and opened up the US market to African producers. With regard to security policy, the fight against international terrorism has been paramount.
In Latin America, the normalisation of relations with Cuba has strengthened the USA’s political and economic position. Under Trump there is a great risk that the entire region could fall back into old patterns of conflict. Protectionism and the policy on illegal immigrants could revive anti-Americanism.
Policy Implications
During Obama’s presidency, the USA’s reputation and the foundations of a US-supported liberal world order have been strengthened. Obama’s newly elected successor is now calling both into question. The European Union and German politics should respond with more foreign policy independence and the expansion of reciprocal relationships with Africa, Asia, Latin America, and the Middle East.
US-Außenpolitik von Obama zu Trump
Hinsichtlich der Außenpolitik des im November 2016 gewählten US-Präsidenten Donald Trump gibt es noch viele offene Fragen und ihre Konturen werden sich erst in den kommenden Monaten klarer abzeichnen. Allerdings startet Trump nicht in einem außenpolitischen Vakuum und die Herausforderungen, mit denen er sich weltweit konfrontiert sehen wird, unterscheiden sich kaum von denen seines Vorgängers Barack Obama.
Schon früh versuchte Obama, die Deutung seines außenpolitischen Vermächtnisses zu beeinflussen. Ausführliche Interviews mit dem Journalisten Jeffrey Goldberg bildeten die Grundlage für den Aufsatz, der im April 2016 in der Zeitschrift The Atlantic unter dem Titel „The Obama Doctrine“ veröffentlicht wurde. Der Kern der Obama-Doktrin bestand darin, das globale Engagement der USA stärker auf deren Kerninteressen zu fokussieren. Obama suchte einen Ausgleich zwischen außenpolitischen und innenpolitischen Herausforderungen, weil der Handlungsspielraum der USA auch vom politischen Rückhalt in der Bevölkerung und von der eigenen wirtschaftlichen Stärke abhängt. Trotz der Stärke der USA war sich Obama der Grenzen der amerikanischen Macht bewusst.
Im Zentrum der außenpolitischen Neuausrichtung der USA seit 2009 standen Bestrebungen, das amerikanische Engagement in Afghanistan und im Irak zurückzufahren (und die Truppenpräsenz zu reduzieren), eine erneute risikobehaftete Verstrickung im Nahen Osten zu vermeiden, das iranische Atomprogramm mit diplomatischen Mitteln (und Sanktionen) zu stoppen sowie die US-Außenpolitik stärker nach Asien auszurichten („rebalance to Asia and the Pacific“). Trotz des Friedensnobelpreises im Jahr 2009 war Obama außenpolitisch keine „Taube“. Wenn notwendig, griff er auch auf militärische Mittel zurück, wie in Libyen, Syrien oder hinsichtlich der Ausweitung der Drohnenangriffe gegen Terroristen und dem Einsatz von Spezialkräften (etwa bei der Tötung von Osama Bin Laden). Obama war darüber hinaus bestrebt, sowohl die Kosten als auch die Verantwortung für Militäreinsätze auf Verbündete zu verlagern, und auf kostengünstige und den Augen der Öffentlichkeit entzogene Mittel zurückzugreifen (Krieg 2016).
Über die zukünftige Außenpolitik von Donald Trump wird viel spekuliert. Unter den außenpolitischen Experten überwiegt die Skepsis. In einem Interview in The Atlantic (Friedman 2016) analysiert der Experte für US-Außenpolitik Thomas Wright (Brookings Institute) dessen politische Aussagen seit den 1980er Jahren und konstatiert im Hinblick auf Elemente wie die Ablehnung von Bündnissen und Freihandel auch eine Sympathie für autoritäre ausländische Machthaber. Der einflussreiche politische Publizist Robert D. Kaplan beklagte in der Washington Post (11. November 2016), dass Trump kein außenpolitischer Realist sei und ihm jegliches Verständnis für historische Zusammenhänge fehle. Er warf ihm vor, die Bedeutung einer nüchternen Analyse zu verkennen. Dies gelte etwa für Machtbalance (zum Beispiel im Hinblick auf die expansive Politik von Putin), Freihandel zugunsten der Verbreitung amerikanischer Werte, eine Wertschätzung des Status quo, außenpolitische Mäßigung und Glaubwürdigkeit, sowie die Notwendigkeit von Allianzen (und die Schutzgarantie gegenüber Verbündeten) für eine stabile internationale Ordnung. Für Kaplan ist Donald Trump der unbelesene Repräsentant eines digitalen Zeitalters, wo „nichts überprüft werde, der Kontext fehle und Lügen verbreitet werden“. Der ehemalige EU-Kommissar für Außenbeziehungen Chris Patten wirft die Frage auf: „Will Trump bring down the West?“ Insgesamt befürchten die kritischen Kommentare, Trump könne als Präsident die Grundsäulen der von den USA getragenen liberalen Weltordnung untergraben und so in den verschiedenen Weltregionen unkontrollierbare Dynamiken auslösen.
Der erste pazifische Präsident
Die hervorgehobene Rolle des asiatisch-pazifischen Raumes in der Regierungszeit von Obama war einerseits durch die bewusste Prioritätensetzung eines Politikers bedingt, der sich selbst als „erster pazifischer Präsident“ bezeichnete und der Region von Anfang an eine strategische Priorität einräumte. Andererseits wurde dies durch die Dynamik der regionalen Machtverschiebungsprozesse und sich daraus ergebender Spannungen erzwungen. Hillary Clinton legte als Außenministerin das Programm und die Kernziele der sogenannten „Rückkehr nach Asien“ im Jahr 2011 fest: Stärkung von existierenden bilateralen Allianzen und der US-Militärpräsenz, Vertiefung der Beziehungen mit aufsteigenden Mächten wie China, aktive Teilhabe in Regionalinstitutionen, Ausweitung der Handelsbeziehungen und Förderung von Menschenrechten und Demokratie (Clinton 2011).
Der Aufstieg Chinas sticht unter den Prozessen, die die Region während der Amtszeit von Obama prägten, klar heraus. Scheinbar unbeeindruckt von der globalen Finanzkrise wuchs das chinesische BIP von 2009 bis 2014 um 50 Prozent, und die im Jahr 2012 angetretene neue Führung um Xi Jinping erhob durch Projekte wie die „Neue Seidenstraße“ den klaren Anspruch, diese gewachsenen Ressourcen auch für eine bedeutendere globale Rolle Chinas einzusetzen. Im Zuge dieser Machtverschiebung verstärkte sich allerdings speziell in den letzten Jahren auch das strategische Misstrauen auf beiden Seiten. Während die USA diese chinesischen Initiativen als Herausforderung für die eigene Führungsrolle ansahen, zielte die „Rückkehr der USA nach Asien“ für chinesische Beobachter in erster Linie auf die Einhegung Chinas.
Seit dem Jahr 2010 verfolgt China verstärkt seine maritimen Territorialansprüche im Ost- und Südchinesischen Meer, indem es seine zivile und militärische Präsenz vor Ort stetig ausbaut. Als Reaktion haben speziell die Philippinen und Vietnam eine engere militärische Kooperation mit den USA gesucht. Im Südchinesischen Meer unternimmt die US-Marine seit Oktober 2015 Operationen, bei denen Kriegsschiffe bewusst von China reklamierte Territorialgewässer kreuzen. Trotz dieser Spannungen ist eine konstruktive bilaterale Zusammenarbeit mit China notwendig. Kernfragen von Global Governance wie die Eindämmung des Klimawandels konnten bisher oft nur durch eine amerikanisch-chinesische Übereinkunft vorangetrieben werden. Dies setzt allerdings voraus, dass Chinas gewachsene Bedeutung anerkannt und das Land aktiv als „stakeholder“ eingebunden wird. In Nordostasien wurde die Dynamik von den nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogrammen geprägt, die Südkorea und Japan direkt bedrohen und die sich auch durch ein jüngst verschärftes und von China mitgetragenes Sanktionsregime nicht aufhalten ließen. Nicht nur im Umgang mit dieser Frage konzentrierte sich Obama darauf, regionale Alliierte zu mehr aktiver sicherheitspolitischer Unterstützung zu bewegen: Die japanische Regierung öffnete im Jahr 2015 den Weg für die Teilhabe an kollektiver Selbstverteidigung, und mit Südkorea einigte man sich auf die Stationierung eines neuen Raketenabwehrsystems. Andauernde Differenzen der beiden US-Alliierten erschwerten jedoch eine trilaterale Zusammenarbeit.
Obwohl mit Indien kein formelles Bündnis besteht, wurde dieses Land von den USA bereits unter der Regierung von George W. Bush als strategischer Partner mit konvergenten Interessen behandelt und seine Einbindung in eine US-geführte Netzwerkarchitektur angestrebt. Die „Act East“-Initiative des indischen Premierministers Modi wurde deshalb anerkennend mit der Hoffnung verknüpft, Chinas wachsenden wirtschaftlichen und politischen Einfluss auf Südostasien zumindest teilweise auszubalancieren. Zusätzlich wurde der trilaterale strategische Dialog mit Indien und Japan auf Ministerebene befördert, wobei dessen Schwerpunkte auf maritime Sicherheit und die Förderung regionaler Konnektivität zeigen, wie sehr auch diese Kooperation von der Reaktion auf die Politik Chinas geprägt wird.
Ob dieser Kurs unter der neuen Regierung weiterhin verfolgt werden wird, ist gegenwärtig sehr fraglich. Während des Wahlkampfes kritisierte Trump die Kosten der amerikanischen Militärpräsenz in Japan und Südkorea und forderte eine stärkere Eigenvorsorge dieser Staaten, die explizit auch eine atomare Bewaffnung einschließen könne. Angesichts der Unterentwicklung kollektiver Sicherheitssysteme in der Region und historischer Spannungen zwischen den Staaten Nordostasiens könnten solche Bemühungen unkalkulierbare Rüstungswettläufe auslösen. In Handelsfragen steht die Transpazifische Partnerschaft (TPP), die ökonomische Kernkomponente der „Rückkehr nach Asien“, wohl vor dem Aus, und Trumps protektionistische Agenda birgt Konfliktpotenzial speziell im Umgang mit den exportorientierten Wirtschaften Asiens – gegenüber China wurden bereits hohe Strafzölle angedroht.
Bei anderen „weichen“ Zielen der Asien-Agenda fällt die Bilanz sehr unterschiedlich aus. Mit insgesamt elf Reisen in die Region zeigte Obama mehr Präsenz als jeder seiner Vorgänger, und durch den amerikanischen Beitritt zu Foren wie dem East Asia Summit wurde der institutionelle Unterbau für ein weitergehendes Engagement speziell mit den ASEAN-Staaten gefestigt. Im Hinblick auf die Stärkung von Menschenrechten und Demokratie ist für Asien eine ambivalente Bilanz zu ziehen. Der Öffnung Myanmars stehen Instabilität und Rückkehr autoritärer Politiken in Thailand und auf den Philippinen gegenüber, was jeweils zur Hinwendung nach China führt. Auch in China ist seit der Regierungsübernahme Xi Jinpings ein klarer Trend hin zu einer Verfestigung der autoritären Strukturen und eines immer massiveren Vorgehens gegen Dissidenten zu beobachten.
Im Ergebnis zeigt sich somit eine gemischte Bilanz der „Rückkehr nach Asien“: Die sicherheitspolitische Führungsrolle der USA wurde klar untermauert und durch das Verhalten Chinas zusätzlich legitimiert, was allerdings auch neue Spannungen im bilateralen Verhältnis erzeugte. Hier wird entscheidend sein, ob sich Trump vom fundamentalen Wert dieser Rolle überzeugen lässt oder ob auf die „Rückkehr“ prompt ein „Rückzug“ folgt. Für die Wirtschaft und den Handel ist sehr fraglich, ob in den USA in den kommenden Jahren noch genügend politischer Wille vorhanden sein wird, die zukünftige Entwicklung Asiens entscheidend mitzugestalten.
Nahostpolitik: Entpolarisierung der Beziehungen zur islamischen Welt
Zur Zeit des Amtsantritts von Barack Obama im Januar 2009 waren die Menschen im Nahen Osten voller Hoffnung, dass das wahlentscheidende Motto des neuen Präsidenten, „Wandel“ (Change) auch für die Außenpolitik der USA zutreffen würde. Sie erwarteten, dass die nach wie vor immense Gestaltungskraft der USA also nicht für militärische Interventionen und das Aufoktroyieren eigener Staatsmodelle, sondern für die friedliche Lösung der zahlreichen Konflikte genutzt werden würde. Tatsächlich hatte Obama schon während seines Wahlkampfes angekündigt, sich insbesondere der Lösung des Nahostkonflikts widmen zu wollen. Er nahm damit nicht zuletzt Anregungen vieler renommierter Think Tanks seines Landes auf, wonach der israelisch-arabische Konflikt das „Prisma“ darstellt, durch das die USA in der arabischen Welt wahrgenommen werden (Cook und Telhami 2008: 9 ff.). Folgerichtig führte Obama eines seiner ersten Telefonate mit dem Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, und gab dem Fernsehsender „Al-Arabiya“ ein ausführliches Interview, in dem er die israelische Siedlungspolitik scharf kritisierte. Der Schwung der ersten Monate kulminierte in einem Friedensangebot, das Obama am 4. Juni 2009 der islamischen Welt in Kairo unterbreitete. Der Westen und namentlich die USA stünden mitnichten in einem Konflikt mit den Muslimen und dem Islam, sondern hätten gleiche Interessen bei der gemeinsamen Bekämpfung derjenigen, die den Namen des Islam für „verächtliche Zwecke“ missbrauchten. Damit schlug er auch Brücken zum gemäßigten politischen Islam.
Einen klaren Bruch mit der Politik seines Vorgängers signalisierte Obama in seiner Kairoer Rede auch mit der Bemerkung, dass keine Nation einer anderen ihr Regierungssystem gewaltsam aufdrängen dürfe. Es war nur konsequent, dass er deshalb im Jahr 2011 den militärischen Rückzug aus dem Irak und 2014 aus Afghanistan anordnete. Die kostspieligen, zum Teil erfolglosen oder fragwürdigen Interventionen waren für Barack Obama eine eindringliche Lektion. Die USA sollten in Zukunft nur aus drei Gründen ein militärisches Engagement im Nahen Osten erwägen und zwar wenn eine der folgenden Situationen eintrete: eine direkte Bedrohung der USA durch den islamistischen Terror, eine Existenzbedrohung des Staates Israel oder die unmittelbare Gefahr der Anwendung von Atomwaffen durch Iran (Goldberg 2016: 8-9). Diese Selbstbeschränkung wurde vor allem im syrischen Bürgerkrieg auf eine harte Probe gestellt. Obama hatte im Sommer 2012 den syrischen Diktator Assad eindringlich davor gewarnt, Massenvernichtungswaffen, insbesondere chemische Kampfstoffe, gegen seine eigene Zivilbevölkerung einzusetzen. Damit würde er eine „rote Linie“ überschreiten. Alle Welt verstand dies als klare Androhung militärischer Gewalt durch die USA, sollte Assad diese Linie tatsächlich missachten. Aber genau das tat er ein Jahr später! Zum Missvergnügen und Unverständnis von Freund und Feind intervenierte Obama nicht. In einer Rede am 30. August 2013 argumentierte er, dass die USA nicht schon wieder Krieg gegen ein islamisches Land führen wollten. Selbst eindringliche Ermahnungen enger Vertrauter, nicht zuletzt seiner damaligen Außenministerin Hillary Clinton, dass die USA ihre Glaubwürdigkeit verlieren würden, ignorierte er. Nur um der Glaubwürdigkeit willen würde er keinen Krieg führen, erklärte Obama (Goldberg 2016: 10).
Obamas Dialogangebot an die islamische Welt im Frühjahr 2009 hatte ausdrücklich die Islamische Republik Iran eingeschlossen. Damit brach er auch in dieser Hinsicht unübersehbar mit der Politik seines Vorgängers, der Iran noch als prominentes Mitglied in der „Achse des Bösen“ gesehen hatte. Ausgerechnet in den Beziehungen zu Iran konnte Obama mit der Unterzeichnung des Atomabkommens im Juli 2015 einen der wohl größten außenpolitischen Erfolge seiner Präsidentschaft erzielen. Obwohl das Abkommen nachfolgend sowohl in den USA als auch Iran in die heftige Kritik der „Falken“ geriet, wurde damit eine nahöstliche Dauerkrise ohne Militäreinsatz gelöst.
Unmittelbar nach dem Sturz der tunesischen und ägyptischen Präsidenten Ben Ali und Mubarak hatte Obama im März 2011 die Unterstützung der Demokratisierungsprozesse in der arabischen Welt zu einer „vorrangigen Aufgabe“ seiner Regierung erklärt. Die USA würden sich nicht aufdrängen, allenfalls aus dem Hintergrund helfen und – nicht zuletzt – jedes Wahlergebnis in den Ländern des „Arabischen Frühlings“ akzeptieren. Damit sandte er ein starkes Signal an die Vertreter und Anhänger des gemäßigten politischen Islam. Die zahlreichen Fehlentwicklungen, Rückschritte und Deformationen, die den „Arabischen Frühling“ in der Folgezeit auszeichneten und die auch andere Regierungen unvorbereitet trafen, sind nicht den USA anzulasten. Die Vorwürfe, die nachfolgend gegen Barack Obama laut wurden, richteten sich vielmehr gegen sein „Versagen“ bei der Einhaltung des Versprechens, den Demokratisierungsprozess zu unterstützen.
Obama hat das Engagement seines Landes in Nahost, nicht zuletzt das militärische, aber nur der Bedeutung angepasst, die er der Region nach der anfänglichen Überbetonung in seiner ersten Amtszeit während der zweiten noch zumaß. Ohne eine deutlich stärkere Beteiligung westlicher und regionaler Verbündeter könnten die USA dort nichts ausrichten. Paradoxerweise scheint Präsident Trump genau diese Politik im Kern weiterverfolgen zu wollen. Aus seinen bisherigen Stellungnahmen lassen sich immerhin zwei wesentliche Positionen ableiten: Erstens sind Schutz- und Sicherheitsgarantien für nahöstliche Partner – bis auf Israel – nicht länger „sakrosankt“. Länder wie Saudi-Arabien müssen sich selbst verteidigen können und wenn nicht (Kuwait, 1990 und 1991), müssen sie viel stärker an den Verteidigungskosten beteiligt werden. Zweitens lassen wohlwollende Wertungen von Politikern wie Saddam Hussein oder Bashar al-Assad darauf schließen, dass er Autokraten auf Grund ihrer verlässlicheren Stabilitäts- und Sicherheitszusagen eine höhere Wertschätzung entgegenbringt als „schwachen“ Demokraten. Das wiederum wäre eine komplette Kehrtwende zur Politik seines Amtsvorgängers Obama.
Keine kohärente Afrikapolitik
Nach Nicolas van de Walle (2016), einer der besten Kenner Afrikas und der amerikanischen Afrikapolitik, stellt die amerikanische Afrikapolitik unter Präsident Obama eine einzige Enttäuschung dar.
Nach dem Amtsantritt von Präsident Obama gab es zunächst Hinweise für ein wachsendes amerikanisches Engagement in Afrika. Dies hatte vor allem mit drei Entwicklungen zu tun: (1) der Zunahme der terroristischen Aktivitäten auf dem Kontinent; (2) den überdurchschnittlichen Wachstumsraten in Afrika, weshalb US-amerikanische Firmen ihr Portfolio in der Region erweiterten; (3) der weitverbreiteten Armut und der sozialen Krisen auf dem Kontinent, die zu Flucht und Migration führten.
Bereits im Jahr 2007 hatte das US-Verteidigungsministerium ein Afrikakommando (U.S. AFRICOM) geschaffen, das während der Amtszeit von Präsident Obama den Kampf gegen den islamischen Fundamentalismus im Sahel und am Horn von Afrika koordinierte. Die USA unterstützten den Kampf gegen Boko Haram, Al Shabab und Terrororganisationen in Niger und Mali. Seit dem Jahr 2014 baute das State Department ein Drohnenprogramm mit Basen in Äthiopien, Niger, Kenia und Dschibuti auf und setzte Drohnen beispielsweise über Somalia ein. Militärische und geheimdienstliche Aktivitäten gibt es auch im Tschad und auf den Seychellen. Bei anderen Konflikten nahmen die USA eine vermittelnde Rolle ein und waren bemüht, eine Verhandlungslösung herbeizuführen, wie zum Beispiel im Südsudan und Sudan. An den Großen Seen haben die USA die Friedensmissionen der Vereinten Nationen unterstützt und humanitäre Hilfe gewährt sowie versucht, zur Stabilisierung Ruandas und des Kongo beizutragen. Maßnahmen zur Förderung von Demokratie, der Unterstützung militärischer Ausbildung und die Beteiligung an Friedensprozessen in Côte d’Ivoire und dem Sudan werden als positive Beispiele des US-amerikanischen Engagements in Subsahara-Afrika gewertet. Inwieweit die USA den Einsatz gegen Terror und die organisierte Kriminalität in Afrika fortführen werden, bleibt unklar. Es ist nicht absehbar, ob Präsident Trump mit seiner antimuslimischen Rhetorik und seiner Aussage, im Kampf gegen den Terror eine harte Linie zu fahren, tatsächlich eine neue strategische Militärpolitik in Afrika einleiten wird.
Die wichtigste Neuausrichtung in der Afrikapolitik während der Amtszeit von Obama wird jedoch in der verstärkten wirtschaftlichen Zusammenarbeit der USA mit Afrika gesehen. US-Präsident Barack Obama kündigte auf dem Afrika-Gipfel in Washington im Jahr 2014 an, die Investitionen von US-Unternehmen zu unterstützen: Er forderte die afrikanischen Staaten auf, mit Rechtsstaatlichkeit und dem Kampf gegen Korruption die Rahmenbedingungen für mehr Investitionen zu verbessern. Ausdruck dieser vertieften Wirtschaftskooperation mit Afrika ist die starke Zunahme des Handelsaustauschs seit dem Jahr 2010: Das Volumen des Handels zwischen den USA und Subsahara-Afrika übersteigt mittlerweile bei weitem das US-Budget für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit. So beliefen sich die Exporte im Jahr 2015 auf USD 17,8 Mrd. (2014 USD 25,5 Mrd.) und die Importe auf USD 18,9 Mrd. (2014: USD 26,8 Mrd.) (https://ustr.gov/countries-regions/africa). Damit sind die USA nach Europa und China der drittwichtigste Handelspartner Afrikas. Große Bedeutung kommt auch den US-amerikanischen Investitionen auf dem Kontinent zu.
Kurz vor seinem Ablauftermin am 30. September 2015 wurde der bereits im Jahr 2000 verabschiedete African Growth and Opportunity Act (AGOA) bis ins Jahr 2025 verlängert. Von den unilateral gewährten US-Zollbefreiungen profitieren etwa 40 südlich der Sahara gelegene Länder Afrikas. Mit einem Anteil von knapp 70 Prozent macht Erdöl den Löwenanteil des zollfreien US-Imports aus AGOA-Ländern aus. Die Trump-Regierung wird diesen Vertrag voraussichtlich nicht ändern, auch wenn viele afrikanische Experten genau dies befürchten. Die afrikanischen Staaten können sogar indirekt von Trumps protektionistischer Handelspolitik profitieren. Wenn das TTIP-Abkommen mit der Europäischen Union nicht zustande kommt, würden die für Afrika prognostizierten Import- und Exportreduktionen nicht auftreten.
Es gibt Signale aus dem Trump-Umfeld, dass die neue US-Regierung in der Entwicklungszusammenarbeit die Weichen anders stellen und weniger Entwicklungshilfe gewähren wird. Die Republikaner sind überwiegend der Meinung, dass Entwicklungshilfe schädliche Folgen und keinerlei Nutzen für Amerika hat. Unter anderem könnte das vom noch amtierenden Präsidenten Barack Obama initiierte Projekt „Power Africa“ auf der Kippe stehen. Ziel war es, 60 Mio. Menschen Zugang zu Elektrizität zu verschaffen. Hierzu sollen bis 2018 rund sieben Mrd. USD in den US-Haushalt eingestellt werden.
Kritiker der US-amerikanischen Afrikapolitik beklagen die geringe Kohärenz von Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik (van de Walle 2016). Zu viele Programme würden parallel und von verschiedenen Ministerien und halbstaatlichen Organisationen aufgestellt. Letztlich fehlt der US-amerikanischen Afrikapolitik eine übergreifende strategische Vision für die Region. Immer wieder wurden auch die propagierten Prinzipien „gute Regierungsführung“ (good governance) und Demokratie wegen wirtschaftlicher und militärischer Interessen hintangestellt, vor allem bei als wichtig erachteten Partnern wie Uganda, Kenia, Angola und Äthiopien. Es ist vorerst nicht zu erwarten, dass Präsident Trump Initiativen für eine Afrikapolitik starten wird. Wenn Trump seine Voraussage wahr macht, den Klimavertrag zu kündigen, würden die USA – als größter globaler Umweltverschmutzer und besonders verantwortlich für die Klimaerwärmung – die bereits gegenwärtig großen Umweltprobleme Afrikas weiter verschärfen. Die Begrenzung der Einwanderung aus Afrika gehört zum Arsenal des „America First“ und wird dazu beitragen, dass Afrika sich wieder mehr Europa und vor allem China zuwendet.
Ein Neuanfang in den Amerikas
In der Lateinamerikapolitik der USA besteht eine enge Vernetzung von Innen- und Außenpolitik, die es in gleichem Umfang mit anderen Regionen nicht gibt. Verantwortlich hierfür sind die geographische Nähe, gemeinsame Herausforderungen wie der Drogenhandel und vor allem die Migration vieler Lateinamerikaner in die USA und die finanziellen Rücküberweisungen (remittances). Letztere sind für viele Staaten in Zentralamerika und der Karibik ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Trump hatte im Wahlkampf angedroht, die Rücküberweisungen nach Mexiko einzuschränken.
In den USA nimmt der Einfluss der Hispanics – der US-Amerikaner mit lateinamerikanischen Wurzeln – zu. Bereits im Jahr 2020 werden sie ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der USA stellen. Dies erzeugt innenpolitische Ängste und Widerstände vor allem bei weißen Amerikanern. Obama hat sich während seiner Präsidentschaft gegen den erbitterten Widerstand vor allem aus dem republikanischen Lager für die Einbürgerung von bereits länger in den USA lebenden lateinamerikanischen Einwanderern eingesetzt. Donald Trump hatte demgegenüber mit kritischen Aussagen zu illegalen lateinamerikanischen Einwanderern und vor allem zu Mexikanern den Wahlkampf angeheizt. In den so genannten „swing states“ können die Hispanics Präsidentschaftswahlen in die eine oder andere Richtung entscheiden. Im Allgemeinen tendieren die Hispanics zur Demokratischen Partei. Im Jahr 2012 konnte Barack Obama 71 Prozent der Stimmen der Latino Voters auf sich ziehen, die damit entscheidend zu seinem Wahlsieg beitrugen. Bei Hillary Clinton waren es demgegenüber nur 65 Prozent, Donald Trump kam dagegen auf 29 Prozent (PEW Research Center; Krogstadt und Lopez 2016).
Nach den Irritationen während der Präsidentschaft von George W. Bush knüpften sich an die Wahl von Barack Obama viele Hoffnungen. Der Politikwissenschaftler Joseph Tulchin formulierte es so: „Instead of the ugly American, Obama seemed like the good-looking American“ (Tulchin 2016: 150). Die Regierung Obama schlug von Anfang an einen grundlegend anderen Ton gegenüber den südlichen Nachbarstaaten an und akzeptierte Lateinamerika als eigenständigen und selbstbewussten Partner. Gleichzeitig legte sie, wie von vielen politischen Beobachtern angemahnt, eine differenziertere Sichtweise auf Lateinamerika und dessen (außen-)politisch und wirtschaftlich höchst unterschiedliche Subregionen an den Tag. Zum Ende seiner Amtszeit nannte Präsident Obama den wachsenden Einfluss der USA in Lateinamerika als ein Beispiel dafür, dass sein abwägender, nicht auf Drohungen basierender und stattdessen auf diplomatische Mittel zentrierter außenpolitischer Ansatz – die sogenannte „Obama Doktrin“ – erfolgreich gewesen sei. Es gelte, die Kerninteressen (und daraus resultierenden Bedrohungen) der USA zu identifizieren, und sich nicht durch Nebensächlichkeiten wie die antiamerikanischen Tiraden linker Regierungschefs in Lateinamerika ablenken zu lassen. In seinen Gesprächen mit Jeffrey Goldberg (2016) verweist Obama darauf, wie er stoisch die Schimpftirade von Daniel Ortega ertragen habe und von Hugo Chavez ein US-kritisches Buch eines Marxisten entgegengenommen habe.
Vor diesem Hintergrund ist auch der Wandel in der Politik der USA gegenüber Kuba zu erklären. Kuba bedroht keine Kerninteressen der USA. Zugleich belastete die Isolationspolitik gegenüber Kuba zunehmend die Beziehungen mit Lateinamerika. Nachdem Kuba 2012 aufgrund des Widerstandes der USA und Kanadas erneut nicht zum Gipfel der Amerikas (in Cartagena, Kolumbien) eingeladen worden war, hatten die meisten lateinamerikanischen Regierungen unmissverständlich geäußert, dass es kein weiteres Gipfeltreffen ohne kubanische Beteiligung geben werde. Nach vorausgegangenen Geheimverhandlungen kündigte Präsident Obama im Dezember 2014 eine Normalisierung der Beziehungen mit Kuba an. Die kubanische Regierung konnte im April 2015 erstmals am Gipfel der Amerikas in Panama teilnehmen, und Raúl Castro und Obama nutzten die Gelegenheit zu einem bilateralen Treffen. Im Juli 2015 nahmen beide Länder schließlich wieder diplomatische Beziehungen auf. John Kerry reiste zur Wiedereröffnung der Botschaft im August 2015 als erster US-Außenminister seit 1945 nach Havanna. Im März 2016 stattete dann auch Präsident Obama Kuba einen Staatsbesuch ab. Mit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Kuba wurde ein wichtiger Störfaktor in den interamerikanischen Beziehungen beseitigt. Obama hat seinen Nachfolgern ein geordnetes Erbe in Lateinamerika hinterlassen. Allerdings gibt es immer noch einen starken Widerstand – vor allem im republikanischen Lager – gegen eine Normalisierung der Beziehungen mit Kuba. Trump hatte in seinem Wahlkampf bewusst um die Stimmen der Hardliner in der kubanischen Community geworben. Die Stimmen der Wähler mit kubanischen Wurzeln haben einen wichtigen Beitrag zum Wahlsieg von Trump in Florida geleistet. Dort lag Trump vor Clinton, obgleich insgesamt die Hispanics in Florida (mit einem Wähleranteil von 18 Prozent) mehrheitlich für Hillary Clinton stimmten.
Die interamerikanischen Beziehungen sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil amerikanischer Außenpolitik, auch wenn sich die strategische Bedeutung der Amerikas nur selten in der Tagespolitik widerspiegelt. Die USA sind mit Kanada und Mexiko wirtschaftlich eng verflochten und mit dem restlichen Lateinamerika und der Karibik bestehen umfassende Wirtschaftsbeziehungen. Im Jahr 2013 ging fast ein Viertel der US-Exporte nach Lateinamerika und in die Karibik. Zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Interessen haben die USA ein Netzwerk von Freihandelsabkommen in den Amerikas geschaffen, die durch Trumps protektionistische Ankündigungen in Frage gestellt werden. Dies gilt insbesondere für das nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) mit Kanada und Mexiko. Mit dem im April 2016 von 12 Staaten, darunter Kanada, die USA, Mexico, Peru und Chile, unterzeichneten Abkommen zur transpazifischen Partnerschaft (Trans-Pacific Partnership; TPP) sollte das Netzwerk in den pazifischen Raum erweitert werden. Allerdings steht dessen Ratifizierung durch den US-Kongress noch aus, und Donald Trump hat sich gegen das Abkommen ausgesprochen.
Herausforderungen an die zukünftige Außenpolitik
Donald Trump sieht sich mit einer Welt konfrontiert, die nur sehr eingeschränkt allein von den USA gestaltbar ist und in der es viele Mitspieler von Gewicht gibt. Gleichzeitig kann das Handeln oder Nichthandeln der USA weiterhin bei internationalen Krisen oder bei der Bewältigung regionaler oder globaler Probleme den Ausschlag geben. Präsident Obama formulierte im Vorwort zur „National Security Strategy“ von 2015: „Die Frage ist niemals, ob Amerika führen soll, sondern wie wir führen.“ Wir wissen nicht, welche Ratschläge Präsident Obama seinem Nachfolger beim ersten Treffen im Weißen Haus gegeben hat. Vielleicht war es die Handlungsmaxime seiner Außenpolitik, die er einst in kleinem Kreis gegenüber Journalisten geäußert hatte, „don’t do stupid stuff“ (bzw. in der unzensierten Version „don’t do stupid shit“; Rothkopf 2014). Es bleibt zu hoffen, dass der zukünftige Präsident Donald Trump diesem Ratschlag folgen wird.
In Asien muss der bisherige Drahtseilakt fortgesetzt werden, einerseits konstruktiv mit China zusammenzuarbeiten, und andererseits den wachsenden sicherheitspolitischen Bedenken seiner Nachbarstaaten Rechnung zu tragen. Konfliktherde wie das nordkoreanische Atomwaffenprogramm und die schwelenden Inselstreitigkeiten an Chinas maritimer Peripherie werden sich nicht grundsätzlich lösen lassen und erfordern vertrauensvolle Beziehungen zwischen den USA und allen regionalen Akteuren, um die Gefahr einer Eskalation einzuschränken. Durch den Ausbau tri- und multilateraler Modelle ließe sich das Ziel erreichen, die bestehenden Partner näher miteinander zusammenzubringen, sie zu mehr Eigeninitiative anzuregen und gleichzeitig trotzdem eine zentrale Position in regionalen Netzwerken zu behaupten. Ein einseitiger Rückzug hingegen würde die Stabilität dieser auch für die USA so wichtigen Region gefährden, ohne kurzfristig bedeutende Ersparnisse realisieren zu können.
Im Nahen Osten und Nordafrika werden sich die wesentlichen Herausforderungen für Präsident Donald Trump nicht grundlegend ändern: Als Schnittpunkt der Kontinente Asien, Afrika und Europa, als Hauptquelle des nach wie vor wichtigsten Einzelrohstoffs der Weltwirtschaft, Erdöl, und als Geburtsort der drei abrahamitischen Weltreligionen wird die Region ihre überragende strategische Bedeutung genauso behalten wie die daraus abzuleitende überproportionale Konflikthäufigkeit. Seit mehr als einem halben Jahrhundert sind US-Präsidenten mit diesen kaum veränderten Herausforderungen sehr unterschiedlich umgegangen. Obama stellte die grundsätzliche strategische Bedeutung der Region zwar nicht in Frage, konstatierte jedoch einen relativen Bedeutungsverlust für sein Land und reagierte entsprechend. Bei aller sonstiger Gegensätzlichkeit zu Obama steht zu erwarten, dass Präsident Trump gerade diesen Ansatz im Nahen Osten weiter verfolgen wird. Ein klares und geschäftsmäßiges Kosten-Nutzen-Kalkül wird ihn nur punktuell, möglicherweise aber gerade deshalb auch erratisch reagieren lassen. Die Zeit extensiver Sicherheitsgarantien für Verbündete ist aber – mit der entscheidenden Ausnahme Israels – bis auf weiteres vorbei.
In Afrika hat sich der US-amerikanische Einfluss verringert, nicht nur wegen der gestiegenen Präsenz Chinas und der nach wie vor engen Beziehungen der afrikanischen Staaten zu Europa. Die von Obama verfolgte Politik konzentrierte sich auf zwei wesentliche Punkte: die Reaktion auf die Zunahme von Terrorismus vor allem im Sahelgebiet und dem Nordosten Afrikas und die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen. Afrika wird auch zukünftig nur eine geringe Bedeutung in der amerikanischen Außenpolitik zukommen. Weder die wachsende antiwestliche Haltung vieler afrikanischer Regierungen noch die Flucht- und Migrationsbewegungen, mit denen vor allem die europäischen Länder zu tun haben, werden zu einer Korrektur in der Afrikapolitik führen.
In Lateinamerika besteht die Befürchtung, dass Obamas Nachfolger Trump das neu gewonnene Vertrauenskapital verspielt und die für die USA günstige politische Konjunktur nicht ausnutzt. Der ehemalige mexikanische Außenminister Jorge Castañeda warnt bereits: „No region will suffer more under Trump’s presidency than the Western Hemisphere.“ Es ist paradox, dass in Lateinamerika in jüngster Zeit verstärkt Regierungen an die Macht gekommen sind (in Argentinien, Brasilien und Peru), die – anders als der gewählte US-Präsident – auf eine wirtschaftliche Liberalisierung und engere Beziehungen mit den USA setzen. Dementsprechend irritiert reagierten die meisten lateinamerikanischen Regierungen, die zudem auf einen Wahlsieg von Hillary Clinton gesetzt hatten. In Mexiko brach der Peso gegenüber dem US-Dollar ein und auch in den meisten anderen lateinamerikanischen Staaten gaben die Währungen nach. Der Gradmesser für die Bewertung der Lateinamerikapolitik der neuen Regierung werden die Antiimmigrationspolitik, die Handelspolitik, die Beziehungen zu Kuba und die Reaktion auf die autoritären Herausforderungen der Demokratie in Lateinamerika (etwa in Nicaragua und Venezuela sein). Einige Kommentatoren (Boron 2016) gehen sogar soweit, im Wahlerfolg von Trump den Anfang vom Ende eines Zyklus von neoliberaler Globalisierung und Freihandel und neue Chancen für eine linke Politik in Lateinamerika zu sehen. Andere setzen auf eine größere Eigenständigkeit und eine engere Kooperation mit Asien und China (Serbin 2016). Nach den Erklärungen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping während des APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)-Gipfeltreffens in Lima (19.-20. November 2016) ist China bereit, die Handelsbeziehungen mit Lateinamerika auszubauen.
Auch Europa stellt die sich abzeichnende Neuausrichtung der US-Außenpolitik vor große Herausforderungen. Diese könnte aber ebenso eine Chance für eine größere außenpolitische Eigenständigkeit und eine stärkere Kooperation mit Afrika, Asien und Lateinamerika bieten. Wirtschaftlich leben wir in einer multipolaren Welt mit mehreren Wirtschaftszentren. Ein verstärkter US-amerikanischer Protektionismus könnte die Handels- und Investitionsströme umleiten und neue regionale und interregionale Dynamiken induzieren. Allerdings muss sich Europa bei einer Rücknahme US-amerikanischer Sicherheitsgarantien gegebenenfalls auf eine Zunahme regionaler Konflikte einstellen.
Footnotes
References
Boron, Atilio A. (2016), El otro fin de ciclo, 12. November, www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-314026-2016-11-12.html (24. November 2016).
Castañeda, Jorge G. (2016), The Trump Shock in Latin America, 11. November, www.project-syndicate.org/commentary/donald-trump-latin-america-by-jorge-g--casta-eda-2016-11 (24. November 2016).
Clinton, Hillary (2011), America’s Pacific Century, in: Foreign Policy, 11. Oktober, https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ (24. November 2016).
Cook, Steven A., und Shibley Telhami (2008), Addressing the Arab-Israel Conflict, in: Richard N. Haass und Martin S. Indyk, Restoring the Balance. A Middle East Strategy for the Next President, Washington, DC: Saban Center at Brookings, 131-158.
Friedman, Uri (2016), How Donald Trump Could Change the World, in: The Atlantic, 7. November, www.theatlantic.com/international/archive/2016/11/trump-election-foreign-policy/505934/ (24. November 2016).
Goldberg, Jeffrey (2016), The Obama Doctrine, in: The Atlantic, April, www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/ (24. November 2016).
Kaplan, Robert D. (2016), On Foreign Policy, Donald Trump is no Realist, in: The Washington Post, 11. November; www.washingtonpost.com/opinions/on-foreign-policy-donald-trump-is-a-fake-realist/2016/11/11/c5fdcc52-a783-11e6-8042-f4d111c862d1_story.html?hpid=hp_no-name_opinion-card-a%3Ahomepage%2Fstory (24. November 2016).
Krieg, Andreas (2016), Externalizing the Burden of War: The Obama Doctrine and US Foreign Policy in the Middle East, in: International Affairs, 92, 1, 97-113.
Krogstad, Jens Manuel, und Mark Hugo Lopez (2016), Hillary Clinton wins Latino Vote, But Falls Below 2012 Support for Obama, 9. November, www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/hillary-clinton-wins-latino-vote-but-falls-below-2012-support-for-obama/ (24. November 2016).
Oualaalou, David (2016), The Ambiguous Foreign Policy of the United States toward the Muslim World, Lanham: Lexington Books.
Patten, Chris (2016), Will Trump Bring Down the West?, 13. November, www.project-syndicate.org/commentary/trump-threat-to-the-west-by-chris-patten-2016-11 (24. November 2016).
Rothkopf, David (2014), Obama’s ‘Don’t Do Stupid Shit’ Foreign Policy, in: Foreign Policy, 4 June, http://foreignpolicy.com/2014/06/04/obamas-dont-do-stupid-shit-foreign-policy/ (24. November 2016).
Serbin, Andrés, und Andrei Serbin Pont (2016), ¿Borrar y reiniciar? Trump, América Latina y China, 13. November, www.cries.org/?p=3593 (24. November 2016).
Tulchin, Josph S. (2016), Latin America in International Politics. Challenging US Hegemony, Boulder, CO: Lynne Rienner.
Van de Walle, Nicolas (2016), Obama and Africa. Lots of Hope, Not Much Change, in: Foreign Affairs, 94, 5, 54-61.
White House (2015), National Security Strategy, February (24. November 2016).
General Editor GIGA Focus
Editor GIGA Focus Global
Research Programmes
How to cite this article
Nolte, Detlef, Pascal Abb, Henner Fürtig, and Robert Kappel (2016), Donald Trump and the Foreign Policy Legacy of Barack Obama, GIGA Focus Global, 7, Hamburg: German Institute for Global and Area Studies (GIGA), http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-51655-3
Imprint
The GIGA Focus is an Open Access publication and can be read on the Internet and downloaded free of charge at www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus. According to the conditions of the Creative-Commons license Attribution-No Derivative Works 3.0, this publication may be freely duplicated, circulated, and made accessible to the public. The particular conditions include the correct indication of the initial publication as GIGA Focus and no changes in or abbreviation of texts.
The German Institute for Global and Area Studies (GIGA) – Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg publishes the Focus series on Africa, Asia, Latin America, the Middle East and global issues. The GIGA Focus is edited and published by the GIGA. The views and opinions expressed are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of the institute. Authors alone are responsible for the content of their articles. GIGA and the authors cannot be held liable for any errors and omissions, or for any consequences arising from the use of the information provided.