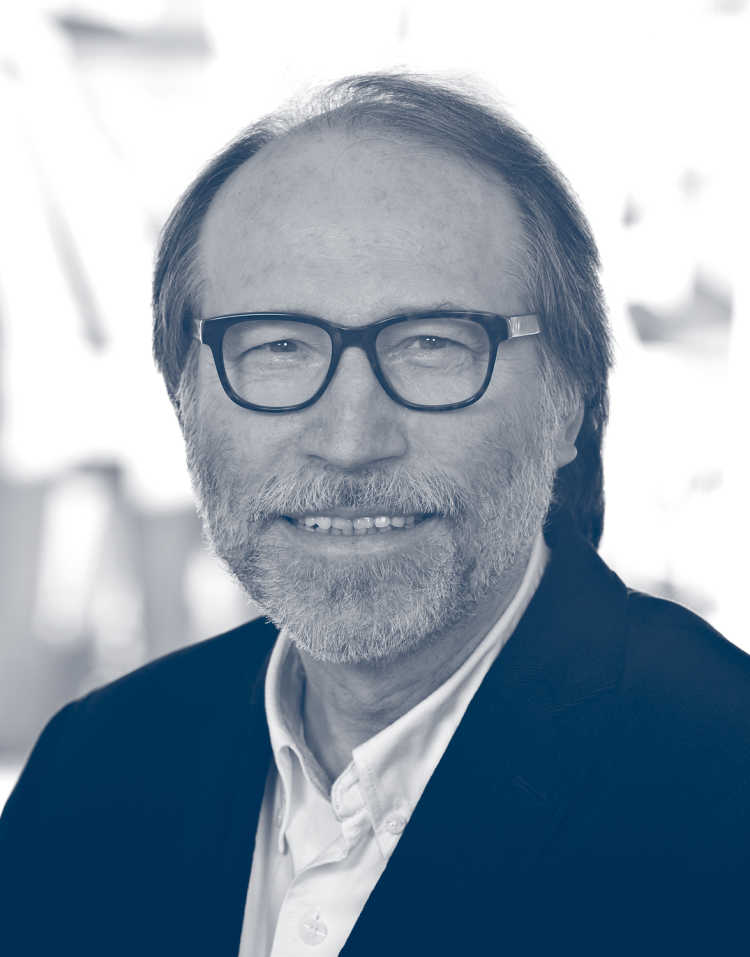- Startseite
- Publikationen
- GIGA Focus
- Kuba nach Raúl: Der Reformdruck bleibt hoch
GIGA Focus Lateinamerika
Kuba nach Raúl: Der Reformdruck bleibt hoch
Nummer 2 | 2018 | ISSN: 1862-3573

Am 19. April wird Kubas Nationalversammlung einen Nachfolger für Raúl Castro im Amt des Staatspräsidenten benennen. Doch das Ende der Ära Castro vollzieht sich in Zeitlupe: Der 86-jährige General bleibt Vorsitzender der Kommunistischen Partei und damit der mächtige Mann im Hintergrund. Dennoch stehen Veränderungen an.
Der designierte Nachfolger Miguel Díaz-Canel ist kein charismatischer Führer, sondern der Typus des loyalen Parteikaders. Er verkörpert den lange versprochenen Generationswechsel. Umso wichtiger ist es der kubanischen Führung, Erwartungen auf weitergehenden Wandel zu dämpfen. Die Geschlossenheit der Elite bleibt oberstes politisches Gebot.
Raúl Castro hat strukturelle Reformen auf die politische Tagesordnung gesetzt. Die Umsetzung blieb jedoch vielfach aus. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage wird die neue Regierung diese Reformagenda jedoch wieder aufgreifen müssen, da sonst das weitere Absinken des Lebensstandards droht.
Unmittelbarer Handlungsbedarf besteht bei der Zusammenführung der beiden im Land zirkulierenden Währungen. Mit diesem Schritt sind jedoch auch Veränderungen in Wechselkurs und relativem Preisgefüge verbunden, deren soziale Kosten schwer abzusehen sind.
Die neue Regierung wird den Kurs diversifizierter Außenbeziehungen fortsetzen. Allerdings wurden Räume für NGOs und internationale Akteure zunehmend eingeschränkt. Akute Devisenknappheit und zentralisierte Strukturen halten Handel und Investitionen auf niedrigem Niveau.
Fazit
Der Veränderungsdruck in Kuba bleibt hoch. Die Rückkehr zu einer graduellen Reformagenda scheint auf mittlere Sicht unvermeidlich. Eine politische Öffnung ist allerdings nicht zu erwarten. Auch wenn am 1. November 2017 das Kooperationsabkommen zwischen der EU und Kuba in Kraft getreten ist, bleibt Kuba ein schwieriger Partner.
Der Nachfolger
Die „historische Generation“ der kubanischen Revolutionsführer läutet ihren Abtritt ein. Doch auch bald 60 Jahre nach dem Triumph der Revolution erfolgt dieser Abgang nur schrittweise, langsam, sehr kontrolliert. Als Fidel Castro im Jahr 2006 erkrankte, übernahm sein Bruder Raúl für weitere 12 Jahre die Staatsführung. Und wenn der 86-jährige Raúl nach zwei Amtszeiten das Präsidentenamt nun in geordneter Form an einen Nachfolger übergibt, so ist die Ära Castro noch immer nicht zu Ende.
Raúl Castros Mandat als Erster Sekretär der Kommunistischen Partei geht noch bis zum Jahr 2021, und es gibt bisher keine Anzeichen, dass er diese Position früher räumen wird. Damit aber bleibt er auch weiterhin Vorsitzender des Politbüros, dem obersten Machtzentrum des politischen Systems. Zudem bleibt Raúl Castro auch der einzige 4-Sterne-General der kubanischen Armee.
Dennoch ändert sich das politische Gefüge des kubanischen Sozialismus. Wenn die Nationalversammlung am 19. April, wie zu erwarten steht, den bisherigen Ersten Vizepräsidenten Miguel Díaz-Canel zum neuen Vorsitzenden des Staatsrats wählt, dann wird dieser damit zwar formales Staatsoberhaupt des Landes. Er wird der erste in dieser Position sein, der nach der Revolution von 1959 geboren wurde. Aber er wird auch weit von der Machtfülle entfernt sein, die einst Fidel und in der Folge auch Raúl besaßen. Diese standen in Personalunion an der Spitze der drei Säulen der Macht in Kuba: Partei, Staat und Militär. Díaz-Canel nicht. Er hat keine Hausmacht. Er muss balancieren. Eigene Handlungsmacht wird er erst mit der Zeit entwickeln können. Zunächst aber erscheint das Institutionengefüge als festes Korsett für einen Mann, dessen gesamte Karriere im Partei- und Staatsapparat verlief.
Seinen Aufstieg ins höchste Staatsamt verdankt Díaz-Canel ganz unmittelbar Raúl Castro. Schon mit nur 33 Jahren war er Erster Parteisekretär in der Provinz Villa Clara gewesen, dann in der Provinz Holguín. Er war Vize des Kommunistischen Jugendverbandes und Hochschulminister. Auch die militärische Grundierung fehlt nicht. Ausgebildet als Elektroingenieur ging er nach dem Studium für drei Jahre in die Streitkräfte. Dennoch war es eine Überraschung, als Raúl Castro vor fünf Jahren Díaz-Canel zu seinem Ersten Stellvertreter im Staats- und Ministerrat machte. Über Nacht wurde er zum hochrangigsten Politiker seiner Generation. Seitdem hat ihn Raúl systematisch als seinen designierten Nachfolger aufgebaut und in Szene gesetzt. Kaum jemand in Havanna zweifelt daran, dass er der künftige Präsident Kubas sein wird. Wofür er steht, das weiß allerdings auch kaum jemand.
In den fünf Jahren an der Seite Raúls hat Díaz-Canel sehr wenig eigenes Profil gezeigt. Wenn er in den Medien ist, dann meist bei Staatsempfängen, Fabrikbesuchen und Gedenkveranstaltungen. So sind es immer die gleichen zwei, drei Anekdoten, die man hört: Dass in seiner Heimatstadt Santa Clara der schräge Alternativkultur-Club „El Mejunje“ nur dank seines Rückhalts überleben konnte. Oder die Sache mit der „Joven Cuba“-Blogger-Gruppe an der Universität Matanzas. Die hatte auf Druck von oben ihren Blog einstellen müssen – nach einem Treffen mit Díaz-Canel (samt Selfie: lächelnd, Arme väterlich um die Schultern gelegt, im Hintergrund Bilder von Fidel und Raúl) konnte sie wieder online gehen. Auch, dass er als Provinzsekretär nah an den Leuten und für pragmatische Lösungen offen war. Und dass seine Frau bei protokollarischen Veranstaltungen wie selbstverständlich an seiner Seite auftritt – in Kuba ist man eine First Lady nicht gewohnt, da fällt das auf.
Vor allem aber gibt es das Video vom letzten Sommer. In der ganzen Welt auf YouTube zu sehen, und in Kuba von Mund zu Mund weitererzählt. Es zeigt Díaz-Canel (2017) bei einer Schulungsveranstaltung für höhere Kader der Kommunistischen Partei, PowerPoint-Folien inklusive. Die Botschaft: Ich bin ein harter Hund. Zum Beispiel über die Medienprojekte, in denen sich seit einigen Jahren eine digitale Presse von unten herausbildet: „subversiv“, „kultureller Krieg“, „werden wir dicht machen“, „werden wir nicht zulassen“. Und so weiter und so fort. Wie das Video auf YouTube kam? Angeblich ein Leak. Wohl eher: Eine bewusste Inszenierung.
Denn das ist die wichtigste Lehre, die die kubanische KP aus den Umbrüchen in Osteuropa gezogen hat: Die Geschlossenheit der Elite ist zentral für den Machterhalt. Und sie muss nach außen kommuniziert, symbolisch dargestellt werden (Schedler und Hoffmann 2016). Das kann über Fernsehnachrichten und Parteitage, über die Parteizeitung oder Militärparaden erfolgen. Oder auch über ein auf YouTube platziertes Video, wie das mit Díaz-Canel. Seine Message ist letztlich eine einzige: Hier gibt es keine Hard- versus Softliner. Keinen politischen Wandel hinter dem Generationswechsel. Keinen kubanischen Gorbatschow und keinen kubanischen Modrow. Macht euch keine Illusionen. Hier gibt es nur Kontinuität und Einheit der Elite. Nur: Je dicker diese Inszenierung aufgetragen wird, desto mehr wirkt sie auch wie das Pfeifen im Walde.
Reformagenda und Reformblockade
Die Bilanz nach 12 Jahren Raúl an der Spitze des Staates fällt zwiespältig aus. Er hat eine bemerkenswerte Reformagenda angestoßen. Dazu gehört der Rückbau der personalisierten Strukturen, die über Jahrzehnte auf die Übervaterfigur Fidels konzentriert waren. Dieser Übergang vom charismatischen Sozialismus Fidels zum bürokratischen Sozialismus Raúls (Hoffmann 2016a) hat die politische Kultur Kubas nachhaltig verändert. Als Fidel Castro im November 2016 starb, war dies für Kuba noch ein emotionales Ereignis – aber nicht mehr eines, das die politischen Koordinaten verändert hätte.
Kernstück der Raúl’schen Reformagenda war die Wirtschaft (vgl. Torres und Echevarría 2018; Feinberg 2016). Unter Fidel Castro war die Zulassung selbstständiger Arbeit in den 1990er-Jahren lediglich ein Zugeständnis an die widrigen Umstände. Dagegen machte Raúl eine graduelle Öffnung für den Privatsektor zum Programm. Brachliegendes Staatsland wurde an Bauern verpachtet. Die Staatsbetriebe sollten effizienter werden. Und Raúl brachte dieses Programm durch die Institutionen: Der Parteitag der KP im Jahr 2011 verabschiedete ein Leitliniendokument, das den neuen Kurs breit absicherte.
Dennoch ist die Reform stecken geblieben. Die Zahl der registrierten „Arbeiter auf eigene Rechnung“ (trabajadores por cuenta propia) stagniert bei unter 600.000, bei einer Bevölkerung von 11 Millionen Menschen. Die meisten dieser Unternehmungen sind eher kleinteilig, Handwerk, Verkauf und Dienstleistungen, oft mit überschaubaren Umsätzen. Bed & Breakfasts und Restaurants in Privathäusern gehören schon zu den Speerspitzen des neuen kubanischen Unternehmertums.
Es ist das Dilemma der Raúl’schen Reformen, dass diese Öffnung mit angezogener Handbremse nicht ausreicht, um eine Wachstumsdynamik in Gang zu setzen, die die ungebrochene Krise der Staatsbetriebe kompensieren könnte. In den Jahren von 2009 bis 2016 sind fast ein Viertel der Arbeitsplätze im Staatssektor weggefallen – eine Verringerung von 4,25 Millionen auf nur noch 3,25 Millionen Beschäftigte (Statistisches Jahrbuch Kubas, zitiert nach Vidal 2018: 4). Dass die Arbeitslosigkeit in den offiziellen Statistiken nach wie vor bei nur 2 Prozent rangiert, sagt mehr über die Schwächen der Statistik als über die kubanische Ökonomie aus. Ricardo Torres, Vizedirektor des Zentrums für Forschung zur kubanischen Wirtschaft (CEEC) in Havanna, nennt Zahlen: 2,3 Millionen Kubaner im erwerbsfähigen Alter haben keine formale Beschäftigung (Studierende sind bereits rausgerechnet); das sind 35 Prozent der Erwerbsbevölkerung (Torres 2018). Sie melden sich nicht als „arbeitssuchend“, werden daher nicht als „arbeitslos“ geführt, sondern bewegen sich gänzlich im informellen Sektor bzw. Schwarzmarkt. Insofern verhandelt Kuba heute gar nicht nur die Frage: Mehr oder weniger Markt? Vielfach geht es schlicht darum, ob existierende Marktaktivitäten eine legale Grundlage erhalten oder ob sie in der Grauzone des Tolerierten, aber nicht Legalen gehalten werden.
Die Reformagenda hat zudem mehr Effizienz bei den staatlichen Unternehmen eingefordert. Wenn damit Ernst gemacht würde, drohen noch sehr viel mehr Entlassungen. Es ist kaum zu erkennen, wie diese Arbeitskräfte neue, legale Arbeitsplätze finden sollen, wenn nicht die Spielräume für den Privatsektor erweitert werden. Im vergangenen Jahr hat es hier allerdings die entgegengesetzte Entwicklung gegeben: Großgeschrieben wurde Kontrolle, nicht Ausweitung der Spielräume. Die Vergabe neuer Lizenzen für Selbstständige wurde auf Eis gelegt, bestehende Regelungen wurden eingeschränkt, der Kampf gegen Steuerhinterziehung und andere Delikte zur Priorität erklärt. Ein 166 Seiten schwerer Entwurf für ein neues Regelwerk für den Privatsektor, der im Februar bekannt wurde, folgte genau diesem Grundton (Marsh 2018). Seine Umsetzung in dieser Form würde die prekäre Balance zwischen Reform- und Beharrungskräften im Apparat weiter strapazieren.
Die aufgeschobene Währungsreform
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht zurzeit aber eine andere Herausforderung: Die Währungsreform. Bei der letzten Sitzung der Nationalversammlung im Dezember 2017 beschwor Raúl Castro die Abgeordneten, dass die Zusammenführung der beiden im Land zirkulierenden Währungen keinen Aufschub mehr dulde. Seitdem ist die Erwartung gewachsen, dass die Regierung den ersten Schritt dazu noch unter seiner Präsidentschaft tun könnte. Dies ist auch in den Straßen spürbar: Leute versuchen, ihre Ersparnisse in Sicherheit zu bringen, tragen Bargeld auf die Bank. Auf dem Schwarzmarkt geht der Kurs für US-Dollar nach oben.
In der Krise der 1990er-Jahre war der Wert des kubanischen Pesos (CUP) ins Bodenlose gestürzt. Fidel Castros Flucht nach vorne war die Legalisierung des US-Dollars im Jahr 1993, womit ausgerechnet das Geld des imperialistischen Erzfeindes zur Hartwährung der sozialistischen Ökonomie wurde. Als das Land Ende der 1990er-Jahre eine prekäre Stabilisierung erreichte, verbannte die Regierung den ungeliebten US-Dollar wieder. An seine Stelle trat eine fest an den US-Dollar gekoppelte kubanische Hartwährung, der sogenannte „Konvertible Peso“, im Alltag nach seinem Währungskürzel „CUC“ genannt.
Im Hinblick auf Inflationsbekämpfung ist Kubas Zwei-Währungssystem durchaus eine Erfolgsstory: Seit seiner Einführung Mitte der 1990er-Jahre ist der CUC eine stabile Währung. Auch der kubanische Peso hat seine Hochinflationszeit hinter sich gelassen. Das Drama jedoch liegt im Wechselkurs zwischen CUP und CUC – denn dieser liegt bei 25:1. Und diese Kluft zwischen den beiden Währungen zerreißt Ökonomie und Gesellschaft des Landes. Die Löhne im Staatssektor werden unverändert in CUP gezahlt. Dem jüngsten Bericht des kubanischen Statistikamtes zufolge liegt der durchschnittliche Monatslohn bei 740 CUP. An den staatlichen Wechselstuben erhalten die Kubaner dafür nicht einmal 30 CUC. Damit liegt der Durchschnittslohn bei umgerechnet 28 EUR – pro Monat, wohlgemerkt. Wer ein Bed & Breakfast für Touristen betreibt, bekommt diese Summe für eine Übernachtung.
Angesichts derartiger monetärer Ungleichgewichte ist die Motivation, im Staatssektor zu arbeiten, gering. Niedrige Arbeitsdisziplin und das alltägliche „Abzweigen“ von Produkten und Arbeitsmitteln machen Staatsbetrieben und Verwaltung zu schaffen. Wer andere Möglichkeiten hat, sucht sein Auskommen im Privatsektor, in der informellen Ökonomie oder im Ausland.
Seit fünf Jahren hat die Regierung die Rückkehr zu einer einzigen Währung zur drängenden Aufgabe der Reformen erklärt. Der erklärte Plan der Regierung ist es, den traditionellen kubanischen Peso (CUP) wieder zur einzigen Währung des Landes zu machen und den CUC abzuschaffen. Schon vor Jahren wurde ein Gesetzesdekret verabschiedet, dass die Modalitäten für den „Tag X“ der Währungsumstellung festlegt. Nur ist der „Tag X“ immer wieder vertagt worden. Pilotprojekte wurden gestartet und vorbereitende Schritte unternommen. War bis dato der 100 Peso-Schein der größte Wert, wurden neue 200-, 500- und 1.000 CUP-Scheine gedruckt. Die einstigen Devisenläden preisen inzwischen alle Produkte in beiden Währungen aus und nehmen sowohl CUC und CUP an. Der Kurs ist aber auch hier 1:25. Die Preise orientieren sich nicht an den Peso-Löhnen, sondern an den Importkosten plus Aufschlag. Wenn der Liter Speiseöl hier 2,40 CUC kostet, ist das, auch wenn nun in CUP gezahlt werden kann, noch immer fast ein Viertel einer durchschnittlichen Monatsrente.
Dazu kommt: Während die staatlichen Wechselstuben CUC und CUP zum Kurs 1:25 tauschen, leben die Staatsbetriebe immer noch davon, dass für sie eine 1:1-Parität zwischen CUC und CUP berechnet wird – auch wenn diese nicht ökonomisch begründet, sondern administrativ gesetzt ist. Damit aber wird auch das große Problem der Währungsreform deutlich: Die Aufgabe ist weit größer, als eine Währung aus dem Verkehr zu ziehen. Dies kann bestenfalls der erste Schritt sein. Die tiefer gehende Herausforderung ist es, das völlig verzerrte Lohn- und Preisgefüge wieder in die Balance zu bekommen. Dies aber erfordert eine Operation am ganzen Körper der sozialistischen Ökonomie Kubas, mit kaum kalkulierbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen.
Ende März trat das Plenum des Zentralkomitees zusammen, das letzte Mal, bevor Raúl Castro am 19. April die Präsidentschaft des Landes abgeben wird. Soweit es die Parteizeitung wiedergab, war seine Bilanz des wirtschaftlichen Reformprozesses ernüchternd (Martínez Hernández und Puig Meneses 2018). Seit dem Jahr 2016 sei der Wandel kaum noch vorangekommen: Planungsfehler, mangelnde Investitionen sowie ungenügende Koordination mit den mittleren und unteren Verwaltungseinheiten und Parteiorganisationen. Die „Aktualisierung des Wirtschaftsmodells“ habe sich als sehr komplex erwiesen. Mehr Kontrolle und Disziplin wird angemahnt, aber konkrete Schritte werden nicht benannt. Auch für die Währungsreform werden weder Form noch Termin genannt. In der Vergangenheit sei man, heißt es recht kryptisch, „nicht immer mit ausreichend ganzheitlichem Blick“ an diese Fragen herangegangen, man habe „eine begrenzte Sicht auf die Risiken gehabt“ und „Kosten und Nutzen unvollständig abgewogen“. Was alles nicht danach klingt, als ob ein großer Wurf bevorsteht, sondern eher nach einem weiteren Vertagen schmerzhafter Entscheidungen.
Neue, alte soziale Ungleichheiten
Es ist das Dilemma der kubanischen Wirtschaftsreform, dass sie nicht weit genug geht, um eine tragfähige Wachstumsdynamik in Gang zu setzen, und dass sie gleichzeitig aber schon zu weit geht für das, was Staat und Partei für politisch noch zu bewältigen halten. Denn in der Tat sind mit der begrenzten Reform der vergangenen Jahre schon so große soziale Ungleichheiten sichtbar geworden, dass sie Gegenreaktionen hervorrufen. Dabei: im internationalen Vergleich sind die sozialen Gegensätze auf Kuba immer noch viel geringer als etwa zwischen Favelas und Reichenvierteln in Rio de Janeiro oder sonst wo in Lateinamerika. Aber in Kuba unterminieren sie die Legitimationsgrundlagen von Revolution und Sozialismus.
Besonders bitter ist, dass Kubas neue Ungleichheiten viele der alten, vorrevolutionären Hierarchien der kubanischen Gesellschaft reproduzieren. In gewisser Weise schlägt hier das Exil zurück. Denn mit geschätzten 3 Mrd. USD pro Jahr sind die Geldsendungen der Emigranten eine für das ökonomische Überleben des Landes unverzichtbare Einnahmequelle. Diese Überweisungen aus dem Ausland – im Fachjargon: Remittances – werden entlang der Familienbande geschickt. Und emigriert sind nach dem Jahr 1959 vor allem diejenigen, die etwas zu verlieren hatten: Die überwiegend „weiße“ städtische Ober- und Mittelschicht. Entsprechend strukturiert sind heute die Remittances-Empfänger auf der Insel. Und zur Größenordnung: Über Remittances kommen heute fast achtmal mehr Dollars ins Land als durch Tabak- und Zigarrenexport. Je nach Schätzung liegen sie mit 3,5 bis 4 Mrd. USD sogar höher als die gesamten Tourismuseinnahmen der Insel (Morales 2017). Damit aber haben soziale Herkunft und Hautfarbe im sozialistischen Kuba wieder eine Bedeutung erlangt, die lange überwunden schien (Hansing 2017).
Schon in den 1990er-Jahren, als die Regierung den US-Dollar legalisierte und damit erstmals in großem Stil Remittances ins Land kamen, brachten sie ihren Empfängern Konsummöglichkeiten weit über denen der anderen Kubaner. Doch heute geht das Geld der Verwandten nicht mehr nur in den Konsum, sondern es kann investiert werden. Die Kühltruhen der Restaurants und die Klimaanlagen frisch renovierter Frühstückspensionen sind oft innerfamiliäre Investitionen der Verwandten aus Miami. Das gleiche gilt für den Kauf von Wohnungen und Häusern, seit unter Raúl Castro der Immobilienmarkt – wenn auch in engen Grenzen – legalisiert wurde.
Ein Forschungsprojekt am GIGA hat eine Befragung mit mehr als 1.000 Kubanern auf der Insel durchgeführt, um ein empirisch abgesichertes Bild der neu entstehenden sozialen Ungleichheiten zu erhalten (siehe GIGA-Forschung zum Thema am Ende des Focus). Die Ergebnisse belegen diese Re-Stratifizierung der kubanischen Gesellschaft entlang der Hautfarbe: 93 Prozent der befragten „Weißen“ haben Verwandte im Ausland, dagegen nur 34 Prozent der Afro-Kubaner. Afro-Kubaner haben durchschnittlich deutlich weniger Einkommen als „Weiße“. Hinzu kommt, dass aus der Zeit vor der Revolution herübergerettetes Wohneigentum der zentrale Schlüssel zu den lukrativsten Einnahmemöglichkeiten ist. Auch wenn Mietwohnungen enteignet wurden, durfte jede der wohlhabenden Familien doch ein Haus für die private Nutzung behalten. Es sind diese Immobilien, in denen Wohnzimmerrestaurants und Kleinhotels entstanden sind. Wer vor dem Jahr 1959 zu den Armen gehörte, hat hieran heute nur in wenigen Ausnahmefällen teil. In der durchgeführten Umfrage des GIGA waren 69 der Befragten Vermieter von Wohnungen an Touristen; 68 von ihnen waren „weiß“, ein Einziger Afro-Kubaner.
Vor diesem Hintergrund können die Antireformkräfte im Staatsapparat durchaus Rückhalt in der Bevölkerung mobilisieren, wenn sie die „Neureichen“ attackieren oder die zu hohen Preise der privaten Taxifahrer oder Lebensmittelverkäufer anprangern. Doch die Schere der sozialen Ungleichheit geht keineswegs nur wegen der neuen Marktmöglichkeiten auf, wie es oft dargestellt wird; schwerer wiegt der tiefe Fall der Beschäftigten in der Staatswirtschaft. Denn nur weil die Löhne in Verwaltung und Staatsbetrieben so verheerend niedrig sind, können schon Betreiber kleiner Wohnzimmerrestaurants als „reich“ erscheinen. Das heißt aber auch, dass eine wirkliche Lösung kaum über weitere Restriktionen für Selbstständige zu haben ist, sondern nur darüber, dass Löhne und Renten wieder an Wert gewinnen müssen. Dies zu erreichen, wäre die wichtigste Aufgabe eines Staates, der sich als Garant sozialer Gerechtigkeit versteht.
Kuba-USA: Wieder ziemlich beste Feinde
Die Reformhoffnungen der letzten Jahre hatten auch eine außenpolitische Seite: Die beginnende Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Kuba, die in dem spektakulären Besuch von US-Präsident Obama in Havanna im Jahr 2016 gipfelte. Der Kalte Krieg, so schien es, war nun endlich auch in der Karibik zu Ende gegangen. Mit der Wahl Trumps ist er nun wieder zurück. Zwar hat Trump nicht alle Maßnahmen zurückgenommen. Die diplomatischen Beziehungen bestehen fort, US-Kreuzfahrtschiffe legen weiter in Havanna an, und auch die Überweisungen der US-Kubaner an ihre Verwandten auf der Insel unterliegen keinerlei Beschränkungen.
Dennoch ist die Atmosphäre zwischen Washington und Havanna eisig geworden. Zumal es Trump nicht nur bei aggressiver Rhetorik belassen hat. Außenpolitik ist bei ihm ja immer auch – oder vielleicht auch: zuallererst – Innenpolitik. Der Swing-State Florida war entscheidend für den Sieg Trumps – und wird es auch für die nächsten Wahlen sein. In der Folge hat Trump, so scheint es, die Kubapolitik der USA an den Wortführer der Hardliner in Miami, Marco Rubio, delegiert. Über die vergiftete Rhetorik hinaus haben vor allem drei konkrete Maßnahmen weitreichende Folgen:
Zum einen hat Trump die Bestimmungen wieder verschärft, die US-Bürgern Individualreisen nach Kuba verbieten. Unter Obama waren die Sanktionen hier so weitgehend aufgeweicht worden, dass der Boom der Touristen aus den USA im Jahr 2016 zum dynamischsten Wachstumssektor der kubanischen Ökonomie avancierte. Staatliche Hotels und Mietautos erhöhten massiv ihre Preise und waren trotzdem ausgebucht. Stark profitierte aber auch der Privatsektor, allen voran Unterkünfte und Gastronomie, Taxifahrer, Stadtführer, Übersetzer, Künstler und viele mehr. Seit Trump diese Reisen wieder an komplexe Bewilligungsverfahren geknüpft hat, ist der Besucherstrom aus den USA massiv eingebrochen.
Die zweite Maßnahme Trumps verbietet US-Firmen jegliche Geschäfte mit Unternehmen, die dem kubanischen Sicherheitsapparat unterstehen. Damit zielt er genau auf den am stärksten weltmarktorientierten Teil der sozialistischen Ökonomie. Denn unter Raúl Castro hat das Militär seine Rolle insbesondere in den lukrativen Devisensektoren der kubanischen Ökonomie massiv ausbauen können. Gehörte das wichtigste Tourismusunternehmen „Gaviota“ schon immer den Streitkräften, so hat die Militärholding GAESA inzwischen auch das Sagen über das Gros der Hotels, Restaurants und Geschäfte in der Altstadt Havannas. Aber auch Banken oder die 50 Kilometer westlich von Havanna, am neuen Tiefseehafen von Mariel entstehende Sonderwirtschaftszone werden von den Streitkräften kontrolliert. Gerade diese Sektoren sind dringend auf ausländische Investoren angewiesen. Die Rahmenbedingungen für ein Engagement auf Kuba sind aus einer ganzen Reihe von Gründen schwierig (GTAI 2018: 8-9). Nun kommt für Investoren auch noch die Sorge hinzu, Probleme bei ihren Geschäften in den USA zu bekommen, wenn sie sich auf Deals mit Kuba einlassen.
Die dritte Maßnahme betrifft die diplomatischen Beziehungen. Zwar hat Trump die unter Obama eröffnete Botschaft nicht wieder geschlossen. Aber er hat sie auf ein Minimalniveau reduziert. Zu Hilfe kam ihm dabei ein obskurer Vorfall, bei dem eine Reihe US-amerikanischer sowie kanadischer Botschaftsangehöriger gesundheitliche Schäden davontrugen. Die US-Regierung spricht von einem „akustischen Angriff“. Forscher der Universität Michigan haben eine plausiblere Erklärung: Ihre Analyse des Falls legt nahe, dass es eher ein Unfall war, verursacht durch unbeabsichtigte Ultraschall-Interferenzen aufgrund fehlerhafter Abhörtechnik (Michigan News 2018).
Als Reaktion auf diesen Vorfall hat Washington gleichwohl erklärt, Kuba garantiere nicht die Sicherheit seiner Diplomaten, und in der Folge die Personalstärke auf Notfallstatus heruntergefahren. Dies hat auch unmittelbar praktische Folgen. So stellt die Botschaft in Havanna keine Visa mehr für Reisen in die USA aus; dies obliegt nun der US-Vertretung in Kolumbien. Um sich für ein US-Visum zu bewerben, müssen Kubaner nun nach Bogotá fliegen und dort ihr Anliegen vorbringen. Es fällt schwer, dies nicht als beabsichtigte Schikane zu verstehen.
Wirtschaftlich verschärft das Ende der Entspannungspolitik mit Washington Kubas Probleme erheblich. Innenpolitisch aber dürfte es eher stabilisierend wirken: Nichts schweißt Elite und Volk in Kuba besser zusammen als Sanktionen und Drohgebärden aus Washington. Trump verspricht, die Rolle des „Ugly American“ verlässlich zu geben. Politisch war die Charmeoffensive Obamas für die kubanische Führung das viel größere Problem.
Beziehungen zu Europa
Kuba wird auch nach der Ablösung Raúl Castros an der Staatsspitze den Kurs diversifizierter Außenbeziehungen fortsetzen. Dem Land bleibt wenig anderes übrig, nicht nur wegen der neuen US-Politik. Der wichtigste Verbündete Venezuela befindet sich in einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise, deren Ende noch nicht absehbar ist. China ist ein wichtiger Handelspartner – aber keine neue Sowjetunion, die die Karibikinsel auf Dauer subventionieren würde. Ganz im Gegenteil: Da Kuba ausstehende Rechnungen nicht bezahlen konnte, kürzte China im vergangenen Jahr seine Ausfuhren nach Kuba um nicht weniger als 30 Prozent (Vidal 2018: 5). Auch wenn Russland sein Engagement in Kuba wieder verstärkt, kann es diese Rückgänge kaum kompensieren.
Umso wichtiger ist für Kuba das am 1. November 2017 in Kraft getretene Kooperationsabkommen mit der EU (Council of the European Union 2016). Das „Political Dialogue and Cooperation Agreement” (PDCA) – so der offizielle Name – bleibt in vielem vage, aber schafft doch einen grundsätzlich positiveren Rahmen für die beiderseitigen Beziehungen. Dies schlägt sich freilich nicht automatisch in intensiveren Wirtschaftsbeziehungen nieder. Aller Handel mit der Insel wird von den Zahlungsschwierigkeiten Kubas überschattet. Zahlungsverzögerungen von 360 Tagen sind die Regel, einige staatliche Abnehmer haben den Zahlungsverzug für erhaltene Waren inzwischen schon auf zwei Jahre ausgedehnt (GTAI 2018: 10). Es braucht Unternehmen mit langem Atem, um trotzdem in solche Geschäfte einzusteigen.
Die Signale in den deutsch-kubanischen Beziehungen sind trotz des Kooperationsabkommens gemischt (Hoffmann 2016b). Ein angestrebtes deutsch-kubanisches Kulturabkommen kam nicht zustande. Eine Initiative für ein Goethe-Institut in Havanna, die die kubanische Seite ursprünglich unterstützt hatte, wurde letzten Endes von den Hardlinern im Apparat wieder gestoppt. Die auf Kuba tätigen deutschen Stiftungen haben mit mehr bürokratischen Auflagen denn je zu kämpfen. Die Welthungerhilfe musste ihre Projektarbeit in Kuba ganz einstellen. Gespräche über ein Abkommen zur Aufnahme der Entwicklungszusammenarbeit, die in Folge des Besuchs von Außenminister Steinmeier auf der Insel im Jahr 2015 begonnen worden waren, sind bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Immerhin, im Oktober 2017 konnte ein Büro der deutschen Wirtschaft in Havanna eröffnen, das deutsche Firmen vor Ort unterstützen und ihnen Kontakte vermitteln soll (GTAI 2018: 6-7).
Für Europa und für Deutschland bleibt Kuba ein schwieriger Partner. Die zentralisierten Strukturen und das hohe staatliche Kontrollbedürfnis erschweren die Zusammenarbeit. Ohne weitere Reformschritte der kubanischen Regierung wird auch künftig die Kooperation in Wirtschaft, Politik und Kultur hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Gleichzeitig aber ist Kuba ein ungebrochen beliebtes Reiseland bei den Deutschen, und jenseits der zwischenstaatlichen Ebene besteht in vielen Bereichen ein bemerkenswert breites Netz an Beziehungen. Hierauf gilt es aufzubauen. Gerade in Zeiten der erneuerten Konfrontationspolitik aus Washington ist es wichtig, dass die Europäische Union den eingeschlagenen Weg eines kritisch-konstruktiven Engagements weiter verfolgt.
Fazit
Kubas kritische Wirtschaftslage und die sich daraus ergebenden sozialen Probleme lassen den Veränderungsdruck in Kuba weiter hoch bleiben. Wo Raúl Castro dabei ist, das Präsidentenamt an einen nach dem Triumph der Revolution geborenen Nachfolger zu übergeben, signalisieren Staat und Partei nach Kräften politische Kontinuität und Elitenkohäsion. Nicht Aufbruch, sondern Kontrolle und Beharrung sind die Botschaft der Stunde. Gleichwohl stellen die unter Raúl Castro nur angestoßenen, aber nicht umgesetzten Reformen eine schwere Last für seinen Nachfolger dar. Die benannten Probleme sind nicht geringer geworden. Auf mittlere Sicht scheint die Rückkehr zu einer wirtschaftlichen und auch politischen Reformagenda unvermeidlich.
In dem Maße, in dem Raúl Castro und die „historische Generation“ der kubanischen Revolutionäre sich allmählich von den Schalthebeln der Macht zurückziehen, basiert die Macht im Lande auf dem institutionellen Zusammenspiel von Kommunistischer Partei, Militär und Staatsapparat, nicht auf einer Führungsfigur. Der Handlungsspielraum des künftigen Staatspräsidenten ist damit sehr beschränkt. In einer solchen Konstellation sind auch weiterhin nur langsame, schrittweise Veränderungen zu erwarten, keine radikalen Umwälzungen.
Fußnoten
Literatur
Council of the European Union (2016), Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Union and Its Member States, of the One Part, and the Republic of Cuba, of the Other Part, 25. November, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12504-2016-INIT/en/pdf (22. März 2018).
Díaz-Canel, Miguel (2017), Conferencia para cuadros del Partido Comunista (Video-Ausschnitte), www.youtube.com/watch?v=l6cruK_KRzs (6. April 2018).
Feinberg, Richard E. (2016), Open for Business: Building the New Cuban Economy, Washington, DC: Brookings Institution Press.
GTAI (Germany Trade and Invest) (2018), Licht und Schatten in Kuba– Nischenmarkt mit Chancen, Berlin: GTAI (6. April 2018).
Hansing, Katrin (2017), Race and Inequality in the New Cuba: Reasons, Dynamics, and Manifestations, in: Social Research: An International Quarterly, 84, 2, 331-349.
Hoffmann, Bert (2016a), Bureaucratic Socialism in Reform Mode: The Changing Politics of Cuba’s Post-Fidel Era, in: Third World Quarterly, 37, 9, 1730–1744.
Hoffmann, Bert (2016b), Wandel und Annäherung: Perspektiven deutsch-kubanischer Beziehungen in Kultur und Bildung, Stuttgart: Institut für Auslandsbeziehungen.
Martínez Hernández, Leticia und Yaima Puig Meneses (2018), Analizó V Pleno del Comité Central del Partido importantes temas de la actualización del modelo económico y social, in: Granma, 26. März, www.granma.cu/cuba/2018-03-31/analizo-v-pleno-del-comite-central-del-partido-importantes-temas-de-la-actualizacion-del-modelo-economico-y-social-cubano-26-03-2018-22-03-07 (5. April 2018).
Marsh, Sarah (2018), Exclusive: Cuban Draft Rules Propose Curtailing Fledgling Private Sector, in: Reuters, 23. Februar, www.reuters.com/article/us-cuba-econ omy-exclusive/exclusive-cuban-draft-rules-propose-curtailing-fledgling-pri vate-sector-idUSKCN1G700I (5. April 2018).
Michigan News (2018), Cuba “Sonic Attacks”: A Covert Accident?, 1. März, http://ns.umich.edu/new/multimedia/videos/25450-cuba-sonic-attacks-a-covert-accident (5. April 2018).
Morales, Emilio (2017), Analysis: Cuba Remittances and the Shifting Pattern of Cuban Emigration, in: Cuba Trade, 27 April (5. April 2018).
Schedler, Andreas und Bert Hoffmann (2016), Communicating Authoritarian Elite Cohesion, in: Democratization, 23, 1, 93–117.
Torres Pérez, Ricardo (2018), Cuentapropismo y cooperativismo: otra decepción; in: Progreso Semanal, 19. Februar , http://progresosemanal.us/20180219/cuentapropismo-cooperativas-cuba-decepcion/ (5. April 2018).
Torres Pérez, Ricardo und Dayma Echevarría León (Hrsg.) (2018), Miradas a la economia cubana. Un acercamiento a la “actualización” seis años después, La Habana: Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).
Vidal, Pavel (2018), Is Cuba’s Economy Ready for the 2018 Leadership Transition?, Cuba Study Group (5. April 2018) (also Spanish version available).
Gesamtredaktion GIGA Focus
Redaktion GIGA Focus Lateinamerika
Lektorat GIGA Focus Lateinamerika
Regionalinstitute
Forschungsschwerpunkte
Wie man diesen Artikel zitiert
Hoffmann, Bert (2018), Kuba nach Raúl: Der Reformdruck bleibt hoch, GIGA Focus Lateinamerika, 2, Hamburg: German Institute for Global and Area Studies (GIGA), http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-56827-2
Impressum
Der GIGA Focus ist eine Open-Access-Publikation. Sie kann kostenfrei im Internet gelesen und heruntergeladen werden unter www.giga-hamburg.de/de/publikationen/giga-focus und darf gemäß den Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz Attribution-No Derivative Works 3.0 frei vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies umfasst insbesondere: korrekte Angabe der Erstveröffentlichung als GIGA Focus, keine Bearbeitung oder Kürzung.
Das German Institute for Global and Area Studies (GIGA) – Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg gibt Focus-Reihen zu Afrika, Asien, Lateinamerika, Nahost und zu globalen Fragen heraus. Der GIGA Focus wird vom GIGA redaktionell gestaltet. Die vertretenen Auffassungen stellen die der Autorinnen und Autoren und nicht unbedingt die des Instituts dar. Die Verfassenden sind für den Inhalt ihrer Beiträge verantwortlich. Irrtümer und Auslassungen bleiben vorbehalten. Das GIGA und die Autorinnen und Autoren haften nicht für Richtigkeit und Vollständigkeit oder für Konsequenzen, die sich aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen ergeben.